CO2-Bepreisung
Definition: Maßnahmen zur Internalisierung von Kosten im Zusammenhang mit CO2-Emissionen
Englisch: CO2 pricing
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta
Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen
Ursprüngliche Erstellung: 12.11.2019; letzte Änderung: 16.04.2025
Unter einer CO2-Bepreisung versteht man ein Instrument der Energiepolitik, welches darauf gerichtet ist, zur Reduktion von klimaschädlichen CO2-Emissionen beizutragen, indem es die damit verbundenen Kosten für die Verursacher (Emittenten) erhöht. Zwar zahlen diese ohnehin bereits z. B. für den Bezug kohlenstoffhaltiger Brennstoffe, jedoch liegen die Kosten oft wesentlich niedriger als die durch die Emissionen verursachten externen Kosten. Hierdurch entstehen falsche Anreize, d. h. Anreize zu einem Verhalten oder Wirtschaften, welches insgesamt mehr Schäden verursacht, als es Nutzen bringt. Dem kann man versuchen, durch eine geeignete CO2-Bepreisung entgegen zu wirken.
Beispielsweise können Großverbraucher elektrische Energie aus Braunkohlekraftwerken an der Strombörse zu Preisen in der Größenordnung von 2 ct/kWh = 20 €/MWh einkaufen, wobei pro Megawattstunde über eine Tonne CO2 emittiert wird. Die dadurch verursachten Klimaschäden können nur grob geschätzt werden, liegen aber vermutlich bei weit über 100 €, also bei weit über dem Fünffachen des gezahlten Strompreises. Die Notwendigkeit einer CO2-Bepreisung ist unter solchen Umständen kaum zu leugnen.
Formen der CO2-Bepreisung
Eine CO2-Bepreisung kann auf ganz verschiedene Weisen erfolgen.
CO2-Steuer
Im einfachsten Fall werden Produkte wie Brennstoffe und Kraftstoffe, deren Verwendung zu CO2-Emissionen führt, mit Energiesteuern belastet, die auch explizit als CO2-Steuern bezeichnet werden können. Die Bepreisung führt dann also zu Steuereinnahmen des Staates, die dieser z. B. für allgemeine Zwecke verwenden kann oder auch zweckgebunden, beispielsweise für Klimaschutzmaßnahmen, für Energieforschung oder zur Unterstützung der Betroffenen, etwa als Fördergelder für die energetische Sanierung von Gebäuden. Denkbar ist ebenfalls, andere Steuern entsprechend zu senken, um die Staatseinnahmen insgesamt nicht zu erhöhen.
Emissionshandelssystem
Anstatt selbst Preise festzulegen, kann der Staat ein Emissionshandelssystem einrichten, welches die Gesamtmenge klimaschädlicher Emissionen begrenzt und Emissionsrechte handelbar macht. Dies führt dazu, dass sich ein Marktpreis bildet, welcher die Knappheit der Emissionsrechte (deren Volumen vom Staat Jahr für Jahr reduziert werden kann) widerspiegelt. Ein solches System erhöht die Preise klimaschädlicher Güter, aber eben auf indirekte Weise. Einnahmen des Staates entstehen, wenn Emissionsrechte vom Staat gegen Bezahlung abgegeben werden.
Einbezug anderer klimaschädlicher Gase
Andere klimaschädliche Gase wie z. B. Methan können sowohl bei einer Steuer als auch bei einem Emissionshandel mitberücksichtigt werden, wobei man den Mengen entsprechend der CO2-Äquivalente umrechnen kann.
Vergleich von CO2-Steuer und Emissionshandel
Eine CO2-Steuer und der Emissionshandel haben den Aspekt der Schaffung von klimafreundlichen Anreizen durch eine Bepreisung gemeinsam. Jedoch gibt es auch sehr wesentliche Unterschiede:
Erhebung
Weniger wichtig für den Vergleich sind Details der Erhebung. Beide Instrumente benötigen eine konsequente Erfassung von Emissionen als Voraussetzung für die Bepreisung. Tendenziell ist die CO2-Steuer bei der Behandlung kleinteilige Emissionen einfacher zu behandeln, da die Entstehung der Preise – festgesetzt durch die Regierung – einfacher ist als auf einem großen Markt.
Planungssicherheit
Während eine CO2-Steuer zu im Voraus klar festgelegten Preisen führt, aber nicht zu einer genau vorhersehbaren CO2-Reduktion, ist es beim Emissionshandel genau umgekehrt: Dort werden die Emissionen politisch vorgegeben, und die Preise bilden sich erst am Markt. Daraus ergibt sich, dass die CO2-Steuer eine wesentlich größere Planungssicherheit beispielsweise für die Unternehmen und die Haushalte ergibt. Zwar muss der Staat die Steuersätze gelegentlich nachjustieren, wenn die Klimaziele über- oder untererfüllt werden oder wenn die Inflation den Geldwert ändert. Jedoch müssen solche Korrekturen nicht sehr oft erfolgen. Schließlich ist es ökologisch unerheblich, ob der Reduktionspfad kontinuierlich wie geplant eingehalten wird oder mit deutlichen Schwankungen.
Einnahmen des Staats
Beide Ansätze können zu Mehreinnahmen des Staates führen, also zu einer Erhöhung der Staatsquote, oder auch nicht – je nach Gestaltung.
Sozialverträglichkeit
Beide Ansätze können sozialverträglich gestaltet werden oder auch nicht, je nach den politischen Präferenzen.
Anfälligkeit auf politischen Druck
Beide Ansätze sind ähnlich empfindlich auf politischen Druck. Solcher kann bewirken, dass entweder CO2-Steuersätze zu gering festgelegt werden (oder dass man zu viele Ausnahmen gewährt), oder aber dass zu große Mengen von Emissionszertifikaten ausgeteilt werden (wie beispielsweise beim EU-Emissionshandel bereits jahrelang geschehen).
Eine garantierte Zielerreichung gibt es in beiden Fällen nicht. Beim Emissionshandel mag es zwar so erscheinen, dass die Zielerreichung durch die begrenzte Menge ausgegebener Emissionsrechte garantiert würde; jedoch entstünde bei einem starken Anstieg der CO2-Preis ein großer politischer Druck, mehr Rechte auszugeben. Manche Ansätze (etwa das Klimapaket 2019 der deutschen Bundesregierung) sehen sogar von vornherein einen Maximalpreis vor, bei dessen Erreichen die Zielerreichung also automatisch aufgegeben würde.
Implementierbarkeit auf nationaler Ebene
Ein großer Unterschied betrifft die Möglichkeit der Implementierung auf nationaler Ebene. Es wäre wohl wenig praktikabel, beispielsweise ein deutsches Emissionshandelssystem parallel zum EU-Emissionshandel aufzubauen. Dies wird auch kaum gefordert; stattdessen wird oft die weitere Verbesserung und verbreiterte Anwendung des EU-Emissionshandelssystems gefordert. Obwohl dieses tatsächlich sehr wünschenswert wäre, sind die entsprechenden Fortschritte bislang in vielen Jahren gering geblieben.
Nationale CO2-Minderungsziele
Zudem hat Deutschland konkret das Problem, seine nationalen CO2-Minderungsziele zu verfehlen; das könnte zu Strafzahlungen führen, also zu einem Abfluss von Mitteln ohne Lösungsbeitrag. Eine auf nationaler Ebene ziemlich problemlos einzuführende CO2-Steuer könnte dieses Problem effektiv lösen und dabei mehrere bisher eingesetzte Instrumente ersetzen. Insbesondere kann diese Steuer für eine Übergangslösung eingesetzt werden, solange eine gesamteuropäische oder gar globale Lösung nicht realisiert werden kann. Der Druck in Richtung solcher Lösungen könnte sogar steigen, da insbesondere wirtschaftsfreundliche Regierungen danach streben dürften, die nationale CO2-Steuer auf diese Weise baldmöglichst wieder abschaffen zu können.
Die wohl wichtigsten Unterschiede zwischen CO2-Steuer und Emissionshandel sind also erstens die Mengensteuerung (beim Emissionshandel) gegenüber der Preissteuerung (bei der CO2-Steuer) und zweitens die Möglichkeit einer nationalen Realisierung, auch als Übergangslösung.
Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen durch einen Grenzausgleich
Eine nationale (oder z. B. auf Europa beschränkte) CO2-Steuer oder ein Emissionshandelssystem kann unfaire Wettbewerbsnachteile der inländischen Industrie zur Folge haben, wenn nämlich ausländische Produzenten mit geringeren oder gar keinen CO2-Steuersätzen und Zertifikatepreisen arbeiten können. Dies wäre nicht nur ungerecht, sondern auch nicht zielführend, weil nämlich eine Verlagerung von Produktion ins Ausland keinen ökologischen Mehrwert bringt – teils sogar im Gegenteil. Man würde dann Emissionen quasi über graue Energie in Importen verstecken, was der einheimischen Energie schadet und dem Klima nichts bringt. Die Vermeidung von Carbon Leakage ins Ausland ist deswegen essenziell für die Tragbarkeit und den Erfolg einer CO2-Steuer.
Als eine Notlösung werden oft z. B. Steuererleichterungen für energieintensive Industrien gefordert, die vom Energieverbrauch der jeweiligen Akteure abhängen. Damit wird jedoch die Lenkungswirkung der CO2-Bepreisung gerade wieder unterminiert; effektiv gibt man damit diese für manche Sektoren wieder auf, und ausgerechnet für die wichtigsten. Um dann doch noch eine ausreichend Wirkung zu erzielen, benötigt man z. B. höhere CO2-Steuersätze für andere Sektoren, was jedoch die CO2-Minderung teurer macht und zu ungerechten Inkonsistenzen führt.
Es gibt jedoch andere Lösungen, um Wettbewerbsnachteile im internationalen Umfeld zu vermeiden, insbesondere in Form eines Grenzausgleichs (Border Tax Adjustments). Dies bedeutet, dass auf importierte Güter eine Abgabe erhoben wird, die sich an den geschätzten CO2-Emissionen orientiert. Das System kann durch die Möglichkeit verfeinert werden, dass die Importeure einen reduzierten Abgabensatz erhalten können, wenn sie niedrigere CO2-Emissionen der Produktion nachweisen können. Damit entstehen nun sogar im Ausland Anreize für weitere CO2-Minderungen. Zwar gäbe es zusätzlich wohl eine Erstattung der CO2-Abgabe für die eigenen Exporteure, damit diese auf ausländischen Märkten nicht benachteiligt würden. Jedoch hätten die inländischen Produzenten wegen des inländischen Markts immer noch erhebliche Anreize, CO2-ärmer zu produzieren.
Der Einsatz eines solchen Grenzausgleichs ist durch das internationale Handelsrecht (etwa auf WTO-Ebene) gewissen Randbedingungen unterworfen, die bei der Realisierung einzuhalten sind. Im Kern geht es darum, dass keine unfairen protektionistischen Abgaben eingeführt werden. Jedoch ist es klar, dass ein CO2-Grenzausgleich gerade einem fairen Wettbewerb dient. Deswegen sieht z. B. das WTO-Regelwerk durchaus Möglichkeiten vor, ein Grenzausgleichssystem zu realisieren. Ähnliches wird ja auch in anderen Bereichen bereits realisiert; beispielsweise gibt es Importsteuern, die Wettbewerbsnachteile durch die Umsatzsteuer vermeiden.
Ein Grenzausgleich wird also notwendig, sobald z. B. auf EU-Ebene ein Emissionshandel oder eine CO2-Steuer mit CO2-Preisen in einer Höhe eingeführt wird, die diese wirklich wirksam macht. Es ist also damit zu rechnen, dass die EU früher oder später ein Grenzausgleichssystem einrichten wird.
Literatur
| [1] | CO2 Abgabe e. V, "Grundlegende Varianten einer CO2-Bepreisung im Vergleich", https://klimaschutz-im-bundestag.de/wp-content/uploads/2019/07/20190711_Vergleich_CO2_Konzepte_Verein_CO2abgabe.pdf |
Siehe auch: Kohlendioxid, Klimaschutz, externe Kosten, CO2-Steuer
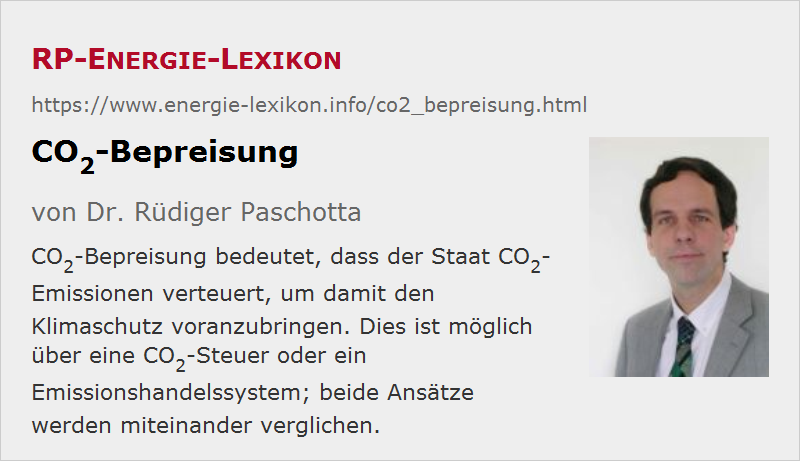
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!