Deponiegas
Definition: ein brennbares Gas, welches in Mülldeponien beim Abbau organischer Stoffe entsteht
Allgemeinere Begriffe: Biogas, Brenngas, Schwachgas
Englisch: dump gas
Kategorien: Energieträger, Ökologie und Umwelttechnik
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta
Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen
Ursprüngliche Erstellung: 14.09.2012; letzte Änderung: 16.04.2025
Wenn organische Abfallstoffe z. B. auf einer Mülldeponie lagern, werden sie durch eine Vielzahl komplizierter Prozesse allmählich abgebaut. Je nach den lokalen Verhältnissen (verfügbare organische Stoffe, Sauerstoffgehalt, Kohlendioxidgehalt, Temperatur etc.) kann der Abbau unterschiedlich verlaufen. Insbesondere bei anaeroben Bedingungen (d. h. praktisch ohne Sauerstoff) können methanbildende Mikroorganismen (sogenannte Archaeen, die nicht zu den Bakterien zählen) sehr aktiv werden. Sie erzeugen ein Gemisch aus dem brennbaren Methan (CH4) und Kohlendioxid (CO2). Der Methananteil liegt anfangs oft oberhalb von 50 %, nimmt innerhalb einiger Jahre jedoch erheblich ab und liegt dann mit der Zeit deutlich unter 25 % (→ Schwachgas). Zusätzlich enthält das gebildete Deponiegas auch Wasserdampf, Stickstoff, Schwefelwasserstoff (H2S) und diverse andere Gase. Nach einigen Jahren geht die Gasproduktion stark zurück, weil die Ausgangsstoffe aufgebraucht sind.
Deponiegas kann im Prinzip als eine Form von Biogas betrachtet werden, da es wie dieses durch biologische Prozesse aus organischem Material entsteht.
Schädlichkeit und Gefährlichkeit des Deponiegases
Wenn das Deponiegas in die Atmosphäre gelangt, hat es wegen des Methans dort eine stark klimaschädliche Wirkung. (Unkontrolliert ausgasende Mülldeponien gehören global zu den bedeutendsten Verursachern von Methanemissionen.) Außerdem entsteht ebenfalls wegen des Methans die Gefahr von Bränden und sogar Explosionen (auch in Gebäuden in der Nähe einer schadhaften Deponie). Beim Einatmen höherer Konzentrationen macht vor allem das Kohlendioxid einen Menschen bewusstlos und kann ihn ersticken. Auch in geringeren Konzentrationen ist das Deponiegas gesundheitsschädlich wegen des (stark stinkenden) Schwefelwasserstoffs und diverser organischer Bestandteile; es können auch Schäden z. B. an benachbarten Wäldern oder auf Äckern entstehen. Gefährlich sind insbesondere plötzliche Ausbrüche von Deponiegas durch Aufreißen einer gasdichten Abdeckung, wenn sich darunter ein hoher Druck aufgebaut hat.
Wegen seiner Schädlichkeit, teils aber auch wegen seiner Nutzbarkeit (siehe unten) sollte Deponiegas, wo es in nennenswerten Mengen anfällt, unbedingt aufgefangen werden: Man spricht von kontrollierten Deponieentgasung als Gegensatz zur umweltschädlichen unkontrollierten Entgasung in die Atmosphäre. Das Gas kann durch "Gasbrunnen" gewonnen werden, die unter einer gasdichten Abdeckung der Deponie verlegt sind. Das über Rohrleitungen gesammelte Gas kann mit einer geeigneten Einrichtung abgefackelt werden, wobei das Methan zu Kohlendioxid und Wasserdampf verbrennt und auch giftige Stoffe wie Schwefelwasserstoff zum guten Teil zerstört bzw. in deutlich weniger schädliche Stoffe umgewandelt werden. Andererseits können auch andere schädliche Stoffe wie Stickoxide, Salzsäuregas (HCl) und Fluorsäuregas (HF) erst bei der Verbrennung entstehen. Mit diversen Maßnahmen (z. B. einer Gasvorreinigung) lassen sich solche unerwünschten Prozesse minimieren. Die bei der Verbrennung freigesetzte Wärme bleibt beim Abfackeln ungenutzt.
Es gibt inzwischen auch modernere Verfahren der Schwachgasentsorgung, beispielsweise mit nichtkatalytischer flammenloser Oxidation, was im Artikel über Schwachgase genauer erklärt wird.
Nutzung von Deponiegas
Eine energetische Nutzung von Deponiegas ist auf verschiedene Weisen möglich:
- Der größte Nutzeffekt entsteht, wenn das Gas in einem Gasmotor oder in einer Gasturbine verbrannt wird, wobei einerseits über einen Generator elektrische Energie gewonnen wird (oder die mechanische Energie für Antriebszwecke dient) und andererseits die Abwärme des Motors bzw. der Turbine ebenfalls genutzt wird (Kraft-Wärme-Kopplung). Die Abwärmenutzung ist allerdings nicht überall möglich; umso wichtiger ist dann ein hoher elektrischer Wirkungsgrad. Ein zu geringer Methananteil des Gases verhindert die Nutzung dieses Schwachgases in Motoren, jedoch sind dafür gewisse Gasturbinen (Schwachgas-Mikroturbinen) noch geeignet – selbst bei Methangehalten von deutlich unter 20 %.
- Anstelle der Verwertung in einer speziell dafür gebauten Anlage ist es möglich, das Gas dem Erdgas z. B. für ein Gaskraftwerk beizumischen (→ Mitverbrennung), soweit ein solches Kraftwerk in der Nähe steht.
- Es ist auch die reine Wärmegewinnung durch Verbrennung in einem Heizkessel möglich. Dieser kann Heizwärme erzeugen oder auch Prozesswärme z. B. für die Erzeugung von Dampf für Industriebetriebe.
- Eine weitere Möglichkeit ist die Aufbereitung des Gases in einer Gasreinigungsanlage, um das Gas dann in das Erdgasnetz einzuspeisen oder lokal zu nutzen.
Die meisten Nutzungsarten setzen jedoch einen genügend hohen Methangehalt voraus, scheiden bei zu stark absinkendem Methangehalt also mit der Zeit aus. Deswegen werden Verfahren entwickelt, die auch Schwachgase mit recht niedrige Methangehalt noch nutzen können.
Da das Deponiegas diverse schädliche Stoffe enthält (siehe oben), kann die Lebensdauer von Gasmotoren und Heizkesseln bei seiner Verwendung unter Umständen durch Korrosion und Ablagerungen verringert werden, wenn keine geeignete Vorreinigung des Gases erfolgt. Eine solche kann auch die Abgasqualität deutlich steigern.
Vermeidung von Deponiegas
Die Bildung von Deponiegas kann auch weitgehend vermieden werden, indem organische Stoffe von der Deponie ferngehalten werden. Beispielsweise können diese abgetrennt und zur Biogaserzeugung genutzt werden. Andere Möglichkeiten sind die Kompostierung und die Verbrennung in Müllverbrennungsanlagen. Da solche Möglichkeiten zunehmend genutzt werden, entstehen heute zumindest in Industrieländern kaum mehr Deponien, die erhebliche Mengen von Deponiegas erzeugen.
Manche Deponien werden auch nachträglich auf einen Betrieb mit Belüftung umgestellt. Im Kern geht es darum, durch Zufuhr von Sauerstoff die anaerobe Umsetzung noch verbleibender organischer Stoffe und damit die Bildung von Methan zu unterbinden.
Siehe auch: Erdgas, Schwachgas, Methan, Gasmotor, Heizkessel, Mitverbrennung
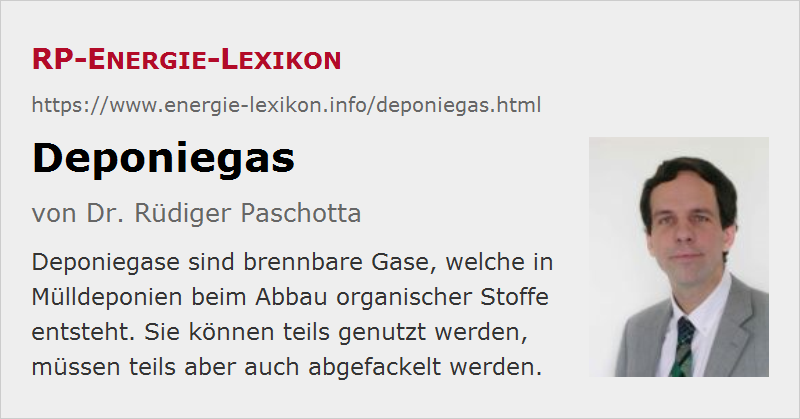
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!