Rechnen mit Energie und Leistung
(Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erschienen in Energie & Umwelt 3/2006, dem Magazin der Schweizerischen Energiestiftung. Das ist lange her, aber natürlich sind alle Inhalte immer noch uneingeschränkt gültig.)
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta
Das Rechnen mit Kilowatt und Megajoule ist kein Hexenwerk. Eine kleine Einführung hilft beim Einstieg und bei der Vermeidung von Fehlern.
Angaben wie "Die Windenergieanlage liefert 350 kW pro Jahr" liest man häufig; bisweilen informieren sie eher über die Grenzen der Kompetenz des Autors als über die Sache. Die Grundzüge des Rechnens mit Energie und Leistung zu beherrschen, erspart nicht nur Blamagen, sondern erlaubt einem vor allem auch interessante Abschätzungen und Vergleiche. Hier soll versucht werden, einige Grundlagen verständlich zu erläutern und ein Gefühl für die involvierten Größen und Zahlen zu vermitteln.
Die Grundlagen
Eine gewisse Menge Energie wird benötigt, um eine bestimmte "Arbeit" im physikalischen Sinne zu verrichten, also z. B. drei Personen um vier Stockwerke anzuheben oder ein Auto gegen Schwerkraft und Reibung über die Alpen zu befördern. Solche mechanische Energie kann auch in andere Energieformen umgewandelt werden, etwa in Wärme oder Elektrizität. Energieverluste im engeren Sinne gibt es bei solchen Umwandlungen nicht, häufig aber eine unvollständige Umwandlung, die effektiv als Verlust wirksam wird. So ist für den Autofahrer der Anteil der durch Verbrennung erzeugten Wärmeenergie, der nicht in mechanische Energie umgewandelt wird, sondern die Umgebung aufheizt, effektiv verloren. Der Wirkungsgrad ist der Anteil der Energie, der in die gewünschte Form umgewandelt werden kann.
Einheiten für Energie
Energie aller Formen kann mit der gleichen Einheit quantifiziert werden, was für viele Rechnungen enorm praktisch ist. Im heute üblichen SI-Einheitensystem ist das Joule (J) die grundlegende Energieeinheit. Wenige Kilojoule (1 kJ = 1000 J) genügen, um ein Fahrrad mit Fahrer einmal ordentlich in Schwung zu bringen. Mit einigen Megajoule (1 MJ = 1000 kJ = 1 Mio. Joule) wäscht man eine Ladung Wäsche, und ein Liter Heizöl liefert (ohne Verluste im Heizkessel) ca. 35 MJ Wärme. Eine weitere gebräuchliche Einheit für Energie (etwa auf Stromrechnungen) ist die Kilowattstunde: 1 kWh = 1 kW · 3600 s = 3 600 000 J.
Ein Sonderfall, praktisch nur noch bei Lebensmitteln gebräuchlich, ist die Kalorie (1 cal = 4,19 J), bzw. die Kilokalorie, also die tausendfache Menge davon: 1 kcal = 4,19 kJ. Übrigens werden immer wieder Kalorien genannt, aber damit in Wirklichkeit Kilokalorien gemeint, während man bei der Unterscheidung zwischen Metern und Kilometern in der Regel genauer ist.
Arg chaotisch geht es im angelsächsischen Bereich zu, wo diverse Nicht-SI-Einheiten immer noch gebräuchlich sind und komplizierte Umrechnungen nötig machen. Ein Beispiel dafür sind die British Thermal Units (BTU).
Leistung = Energiemenge pro Zeiteinheit
Wenn Energie in einer gewissen Zeit umgesetzt wird, bezeichnet die Leistung die umgewandelte Energiemenge pro Zeiteinheit. Die Grundeinheit ist das Watt (W); 1 Watt entspricht einem Joule pro Sekunde und genügt für den Antrieb eines kleinen Spielzeugmotors. Ein Kilowatt (kW) entspricht 1 kJ pro Sekunde oder 3600 kJ = 3,6 MJ = 1 kWh pro Stunde. Wir verstehen nun also die Kilowattstunde (kWh) als die Energiemenge, die ein Gerät mit einer Leistung von einem Kilowatt in einer Stunde umsetzt.
Bei unvollständiger Umsetzung sind verschiedene Angaben möglich: z. B. für einen Dieselmotor bei Autobahnfahrt entweder die aufgenommene Leistung (5 Liter Dieselkraftstoff pro Stunde entspricht 5 · 35 MJ pro Stunde, also 175 MJ / (3600 s) = 49 kJ/s = 49 kW) oder die abgegebene Antriebsleistung von 15 kW. Hier wäre der Wirkungsgrad 15 kW / 49 kW = 0,31 = 31 %.
Für Motoren sind leider immer noch die Pferdestärken (PS) als Leistungseinheit üblich; 1 PS = 0,735 kW. Ein 1500-PS-Motor eines Schiffsantriebs leistet also 1100 kW = 1,1 MW, in dieser Form gut zu vergleichen mit den 300 MW eines Gaskraftwerks. Die Abwärmeleistung des Schiffsmotors von vielleicht 2 MW würde genügen für die Beheizung von 200 kleineren Häusern bei Frost.
Beispiele
Mit dem hier Gelernten wird man nun Kilowatt und Kilowattstunden nicht mehr miteinander verwechseln und auch andere Fehler vermeiden. Die oben genannte Windenergieanlage mag bei vollem Wind eine Spitzenleistung von 350 kW produzieren. Je nach Windverhältnissen am Standort wären es dann z. B. 80 kW im Jahresdurchschnitt, was zu einer Jahresproduktion von 80 kW · 24 (Stunden pro Tag) · 365 (Tage pro Jahr) = 700 800 kWh = 700,8 MWh führen würde. Die Angabe in der Einleitung könnte jedoch durchaus auch so gemeint sein, dass 350 kW die durchschnittliche Leistung ist, entsprechend einer Jahresproduktion von gut 3 Millionen kWh. Man sieht, dass klarere Angaben sehr wünschenswert sind.
Kran
Eine Last von einer Tonne (1000 kg) hat auf der Erde ein Gewicht von 9810 N. Wenn ein Kran diese Last um 1 m anheben soll, braucht er dafür eine Energie von 9810 N · 1 m = 9810 J – zuzüglich Energieverlusten z. B. im Elektromotor. Wenn die Last mit konstanter vertikaler Geschwindigkeit von 2 m/s angehoben werden soll, braucht man eine Leistung von 2 m/s · 9810 N = 19 620 J/s = 19,62 kW (ohne Verluste).
Kaffeemaschine
Eine ältere vollautomatische Kaffeemaschine benötigt zum Aufheizen nach dem Anschalten 24 Sekunden mit 1500 Watt. Dies ergibt eine Energiemenge von 1500 W · 24 s = 36 000 W s = 10 Wh = 0,01 kWh. Wenn dann Kaffee bezogen wird, kommen pro Tasse (150 ml) noch 13 Wh dazu. Erwartet hätte man im Prinzip, dass 150 g Wasser von 20 °C auf 95 °C (also um 75 Kelvin) aufgeheizt werden müssen, was eine Energiemenge von 4,19 J / g K · 150 g · 75 K = 47,1 kJ = 13 Wh ergibt. (Den Strombedarf für die mechanischen Antriebe für die Kaffeemühle, die Pumpe etc. können wir hier vernachlässigen). Das passt also genau, und besser kann es nicht gehen; nur durch das Aufheizen geht nennenswert Energie verloren, nicht durch Wärmeverluste während der kurzen Zeit der Kaffeezubereitung. Dazu kommt allerdings noch ein Standby-Verbrauch von 3,3 W (gemessen); in 24 Stunden ergibt dies 3,3 W · 24 h = 79 Wh. Das hätte sonst für weitere 6 Tassen Kaffee pro Tag genügt, oder für 8 mal Aufheizen. Ein neues Gerät dürfte einen solchen Standby-Verbrauch nicht mehr haben.
Auto
Die größten Leistungen handhabt eine Privatperson meist im Zusammenhang mit dem Auto. Der Motor eines Kleinwagens liefert z. B. maximal 50 kW (= 68 PS) Antriebsleistung aus 180 kW durch Verbrennung von Benzin, gibt also dabei 130 kW als Wärme ab. Der Wirkungsgrad ist dann 28 %. Im Leerlauf leistet er nichts (Wirkungsgrad = 0) und verbraucht immer noch 10 kW in Form von Benzin (gut 1 Liter pro Stunde), die er als Wärme an die Umgebung abgibt. Diese 10 kW würden reichen, ein einigermaßen wärmegedämmtes Einfamilienhaus im Winter warm zu halten. Der Leerlauf eines SUV kann locker auch für ein Zweifamilienhaus reichen. Das erklärt, warum ein informierter Energiesparer unruhig wird, wenn er ein Auto unnötig im Leerlauf betrieben vorfindet.
Gaskraftwerk
Ein großes Gaskraftwerk liefert z. B. 300 MW (1 MW = 1000 kW) elektrisch und gibt eine ähnlich große Leistung in Form von Abwärme an die Umgebung ab. Ein großer Kernreaktor liefert 3 GW = 3000 MW thermisch, woraus ca. 1 GW elektrisch und 2 GW in Form von Abwärme entstehen. So viel Wärme an einem Ort ist schwer zu verwerten und wird deswegen meist über einen Kühlturm in die Atmosphäre und/oder einen Fluss entlassen.
Sonneneinstrahlung auf eine Kleinstadt
Eine deutsche Kleinstadt mag eine Katasterfläche von z. B. 20 km2 haben. Bei voller Sonneneinstrahlung im Sommer führt dies grob geschätzt zu einer solaren Heizleistung von 20 km2 · 1 kW/m2 = 20 Mio. kW = 20 GW auf die Stadtfläche. Das entspricht der zehnfachen Abwärmeleistung des oben genannten Gaskraftwerks.
Auch wenn es im Winter deutlich weniger ist: Nur ein kleiner Teil der Fläche müsste belegt werden, um einen großen Teil des Wärmebedarfs mit Sonnenkollektoren zu decken. Das Problem ist hauptsächlich die dabei benötigte Energiespeicherung. Die ist aber mit einem kommunalen Ansatz (zentraler Wärmespeicher + Nahwärmenetz) kostengünstig realisierbar.
Warmwasser
Wasser hat eine Wärmekapazität von 4,19 kJ / (kg K) – man benötigt also 4,19 kJ, um ein kg Wasser um ein Grad zu erwärmen. Wenn am Waschbecken 15 Liter (also 15 kg) pro Minute durchlaufen, die in der Heizanlage um 50 Grad erwärmt werden müssen, entspricht das pro Sekunde einer Energiemenge von 4,19 kJ · 50 · (15 / 60) = 52 kJ, also einer Wärmeleistung von 52 kW. Vergleicht man dies z. B. mit den 60 W der Deckenbeleuchtung, so versteht man, warum dem Kundigen beim Anblick eines nutzlos laufenden Warmwasserstrahls die Haare zu Berge stehen, während ihn das zehn Minuten lang nutzlos brennende Licht vergleichsweise kühl lässt.
Ein Liter Heizöl hat einen Heizwert von knapp 10 kWh. Das reicht im Idealfall (vernachlässigbare Energieverluste in Brenner, Speicher, Leitungen etc.) aus, um ca. 170 Liter Warmwasser bereitzustellen.
Kälteleitung
Ein Kühlgerät, beispielsweise eine Kältemaschine in einer Klimaanlage, liefert die erzeugte Kälte häufig in Form abgekühlten Wassers. Ähnlich wie beim Warmwasser (siehe oben) kann man die transportierte Kälteleistung aus dem Produkt von Volumenstrom, spezifischer Wärmekapazität und in diesem Falle der Temperaturspreizung (der Temperaturdifferenz zwischen Hin- und Rückleitung) berechnen. Beispiel: Bei einem Wasser-Volumenstrom von 10 l/min (Massenstrom 10 kg/min) und einer Temperaturspreizung von 20 K ergibt sich eine transportierte Kälteleistung von 10 kg / (60 s) · 4,19 kJ / (kg K) · 20 K = 14 kJ/s = 14 kW.
Energieumsatz des menschlichen Körpers
Man vergleiche solche Zahlen mit dem durchschnittlichen Umsatz des Körpers eines erwachsenen Menschen. In diesem Zusammenhang ist aus historischen Gründen die Einheit kcal (Kilokalorien) üblich. Eine Zufuhr von täglich 2000 Kilokalorien durch die Nahrung entspricht 4,19 · 2000 kJ = 8,38 MJ.
Energiesklaven
Der Betrieb eines Autos entspricht bereits im Leerlauf (mit 10 kW = 100 · 100 W durch Verbrennung von Benzin oder Dieselkraftstoff) energetisch dem Einsatz von 100 Energiesklaven, bei mäßig schneller Autobahnfahrt noch 5 bis 10 mal mehr.
Viele meinen, ein natürliches Recht zur beliebig intensiven Nutzung solcher Ressourcen zu haben, Klimagefahren hin oder her – genauso wie früher viele ein natürliches Recht auf Sklavenhaltung reklamierten. So nach dem Motto, wie soll es denn ohne das gehen!
Siehe auch: Energie, Leistung, Joule
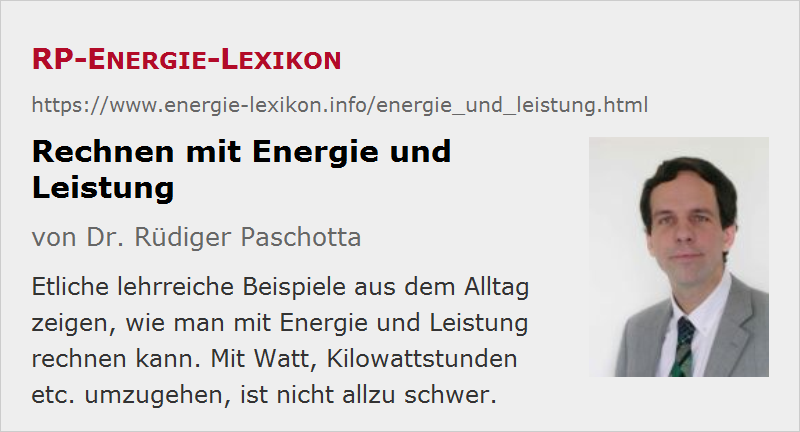
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!