Kühlturm
Definition: eine Anlage zur Abgabe von Abwärme in die Umgebung
Englisch: cooling tower
Kategorien: elektrische Energie, Kraftmaschinen und Kraftwerke, Wärme und Kälte
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta
Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen
Ursprüngliche Erstellung: 29.06.2010; letzte Änderung: 04.05.2025
Ein Kühlturm ist eine Anlage, deren Funktion die Abgabe großer Mengen von Abwärme an die Umgebung ist. Insbesondere Wärmekraftwerke verfügen meist über einen Kühlturm, um die unvermeidlich anfallende Abwärme der Wärmekraftmaschine (meist einer Dampfturbine) abzuführen, soweit sie nicht nutzbar ist (z. B. als Fernwärme). Selbst wenn die meiste Wärme genutzt wird (→ Kraft-Wärme-Kopplung), kann ein Kühlturm unter besonderen Umständen (z. B. verminderter Wärmebedarf im Sommer) die überschüssige Wärme abführen. Unter Umständen wird ein Kühlturm dann auch ständig eingesetzt, um den elektrischen Wirkungsgrad zu erhöhen, indem man den Druck im Kondensator vermindert.

Auch wenn bei einem Kraftwerk Flusswasser zur Kühlung verfügbar ist, wird meist ein Kühlturm eingesetzt, um einen Großteil der Abwärme in die Umgebungsluft abzugeben. Hiermit wird ein allzu hoher Wärmeeintrag in den Fluss vermieden, der sonst negative Auswirkungen z. B. auf die Fische haben könnte. Das zu kühlende Wasser des Kühlkreislaufs fließt dann zunächst durch den Kühlturm und wird erst danach durch einen Wärmeübertrager mit Flusswasser noch weiter abgekühlt, um einen höheren Wirkungsgrad des Kraftwerks zu ermöglichen. Es mag überraschen, dass eine stärkere Abfuhr von Abwärme den Wirkungsgrad steigert, obwohl diese Wärmeenergie doch verloren geht, jedoch arbeitet z. B. eine Dampfturbine effizienter, wenn die Kühlung effektiv ist.
Der Anteil der im Kraftwerk eingesetzten Primärenergie, der schließlich über den Kühlturm abgeführt werden muss, hängt stark vom Typ des Kraftwerks ab. Bei modernen Kohlekraftwerken beträgt der Wirkungsgrad z. B. 45 %, so dass 55 % der Energie als Abwärme anfällt, wovon meist ein Großteil über den Kühlturm abgegeben wird. Bei Kernkraftwerken ist der Wirkungsgrad in der Regel deutlich geringer, z. B. 35 %, so dass 65 % als Abwärme anfallen: Die Abwärmemenge ist fast doppelt so hoch wie die Menge erzeugter elektrischer Energie. Bei gleicher elektrischer Leistung ist die Abwärmemenge ca. um die Hälfte höher als beim modernen Kohlekraftwerk. Nur Hochtemperaturreaktoren, die aber bisher sehr selten eingesetzt werden, erlauben deutlich höhere Wirkungsgrade. Noch extremer ist die Situation bei Geothermie-Kraftwerken, wo wegen der niedrigen Dampftemperaturen der elektrische Wirkungsgrad sehr gering ist – oft in der Größenordnung von 10 %. Wenn Kraft-Wärme-Kopplung praktiziert wird, kann der Energieverlust im Kühlturm natürlich entsprechend geringer ausfallen.
Die Klimaschädlichkeit fossil befeuerter Kraftwerke entsteht im Wesentlichen über die Kohlendioxid-Emissionen und nicht durch die Abgabe von Wärme über Kühltürme. Jedoch würde eine Nutzung der Abwärme z. B. für Heizungen verminderte Emissionen ermöglichen.
Funktionsprinzipien und Bauformen von Kühltürmen
Das elementare Grundprinzip eines Kühlturms ist, dass Wärme vom warmen Kühlwasser auf die kühlere Umgebungsluft übertragen wird. Wegen der geringen Wärmekapazität von Luft müssen durch einen Kraftwerkskühlturm riesige Luftmengen bewegt werden. Dies geschieht in der Regel rein passiv über den Kamineffekt: Die erwärmte Luft im Kühlturm dehnt sich aus, verliert also an Dichte, erfährt somit einen Auftrieb und steigt nach oben. Von unten (am Fuß des Naturzug-Kühlturms) wird frische Luft nachgesogen.
Ein ausreichend starker Kamineffekt erfordert eine gewisse Höhe des Kühlturms. Wesentlich niedrigere Bauformen sind möglich, indem die Luft zusätzlich mit starken Ventilatoren angetrieben wird. Diese erfordert jedoch einen zusätzlichen Energieaufwand, der den Gesamtwirkungsgrad der Kraftwerksanlage beeinträchtigt.
Die Effektivität eines Kühlturms kann deutlich gesteigert werden, indem nicht nur Luft erwärmt, sondern auch Wasser verdunstet wird. In einem solchen Nasskühlturm wird das zu kühlende Wasser versprüht, so dass einerseits ein guter Wärmekontakt mit der Luft erfolgt und andererseits ein kleinerer Teil (wenige Prozent) des umgewälzten Wassers verdunstet. Die Verdunstung erzeugt große Mengen von Verdunstungskälte: Sie führt zur Wärmeabfuhr als latente Wärme. Oberhalb des Kühlturms kondensiert ein Teil des erzeugten Wasserdampfs wieder, wodurch die bekannten Dampfschwaden entstehen, die wegen der erhöhten Temperatur in große Höhen (oft bis zur Wolkendecke) aufsteigen können.
Nasskühltürme sind besonders effektiv, d. h. sie können große Wärmemengen abführen und das Kühlwasser auf relativ niedrige Temperaturen bringen. Nachteile sind der hohe Wasserverbrauch und die Dampfschwadenbildung. Außerdem sind bei Umlaufkühlung (Nutzung des Wassers in einem Kreislauf) Maßnahmen gegen Algenbewuchs, Verkalkung und die Besiedelung mit Legionellen-Bakterien nötig; hier kommen in der Regel Chemikalien zum Einsatz. An besonders kalten Standorten kann die Gefahr des Einfrierens bestehen. All dies wird mit Trockenkühltürmen vermieden, in welchen das Kühlwasser mit der Luft nicht in Berührung kommt; es durchfließt lediglich ein Röhrengeflecht mit Kühlrippen, die die Wärme an die Luft abgeben. Trockenkühltürme sind aber bei Weitem weniger effektiv und beeinträchtigen somit den Kraftwerkswirkungsgrad und/oder müssen noch größer gebaut werden.
Ein Mischlösung ist die Hybridkühlung, bei der ebenfalls Wasser verdunstet wird, aber in geringeren Mengen. Hier sind starke Ventilatoren nötig, mit denen ein warmer Luftstrom dem Dampf beigemischt wird, so dass die Abluft weniger feucht ist und entsprechend weniger starke Dampfschwaden bildet.
In manchen Fällen dient ein Kühlturm auch gleichzeitig als Schornstein. Das Abgas wird also in den Kühlturm abgegeben, und der starke Auftrieb des Kühlturms dient auch zur Beförderung des Abgases in große Höhen. Dies ist besonders nützlich, wenn die Abgastemperatur nach der Rauchgaswäsche relativ niedrig ist, so dass ein gewöhnlicher Schornstein zu wenig Auftrieb brächte.
Auswirkungen auf Atmosphäre, Klima und Gesundheit
Die häufig emittierten großen Dampfschwaden sind der am deutlichsten sichtbare Effekt z. B. eines Kernkraftwerks auf seine Umgebung. Sie haben auch einen gewissen Effekt auf die klimatischen Verhältnisse in der unmittelbaren Umgebung (in einem Radius von wenigen Kilometern), etwa durch eine Beeinflussung von Niederschlägen und der direkten Sonneneinstrahlung.
Da Wasserdampf das wichtigste Treibhausgas in der Atmosphäre ist, könnte man meinen, dass Kühltürme die globale Erwärmung verstärken. Dies ist allerdings nicht der Fall, da der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre im Wesentlichen durch die Temperaturen bestimmt ist. Zusätzliche Emissionen von Wasserdampf führen einfach zu zusätzlichen Niederschlägen, nicht aber zu einem generell wesentlich höheren Wasserdampfgehalt. Auch der Wärmeeintrag in die Atmosphäre ist ökologisch nicht sehr wesentlich. Das zentrale Problem sind die CO2-Emissionen von fossil befeuerten Kraftwerken, abgesehen von zusätzlichen giftigen Emissionen wie Schwefeldioxid, Stickoxiden und Schwermetallen.
Zusätzliche Gesundheitsgefahren können allerdings durch Emission von Legionellen entstehen, wie oben bereits erwähnt. Größere Kühltürme können selbst im Abstand von etlichen Kilometern Infektionen verursachen, wenn eine starke Besiedelung mit Legionellen nicht verhindert wird.
Siehe auch: Kraftwerk, Dampfturbine, Abwärme
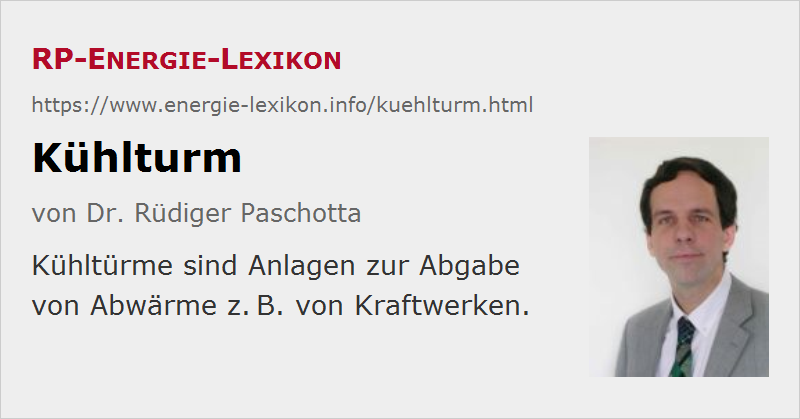
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!