Lüftungsverluste
Definition: Energieverluste, die durch die Belüftung eines Gebäudes entstehen
Alternativer Begriff: Lüftungswärmeverluste
Allgemeiner Begriff: Energieverluste
Englisch: ventilation losses
Kategorien: Energieeffizienz, Grundbegriffe, Haustechnik, Wärme und Kälte
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta
Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen
Ursprüngliche Erstellung: 31.07.2011; letzte Änderung: 04.05.2025
URL: https://www.energie-lexikon.info/lueftungsverluste.html
Jedes Gebäude muss in seinem Betrieb mehr oder weniger belüftet werden, d. h. es muss die Innenluft immer wieder durch frische Außenluft ersetzt werden. Wenn die Außentemperatur unterhalb der gewünschten Innentemperatur liegt, führt dies zu gewissen Energieverlusten, da die Frischluft im Gebäude wieder aufgewärmt wird, während die Abluft Wärme mit sich nach außen trägt. Die Größe dieser Energieverluste hängt freilich entscheidend von der Art der Belüftung ab:
- Im ungünstigsten Fall, der in besonders zugigen Altbauten auftritt, erfolgt zu einem wesentlichen Teil eine unkontrollierte Belüftung durch Undichtigkeiten des Gebäudes. In diesem Falle erfordert eine ausreichende Luftqualität einen höheren Luftaustausch als mit einer kontrollierten Belüftung (siehe unten), da häufig Frischluft in den Raum gerät, dort z. B. an den Heizkörpern oder durch Kontakt mit Wänden und Möbeln erwärmt wird, und teils schon wieder entweicht, ohne vorher "genutzt" worden zu sein. Diese Situation tritt auch bei der Lüftung über gekippte Fenster auf.
- Deutlich günstiger ist die Stoßlüftung über kurzzeitig weit geöffnete Fenster, idealerweise mit Durchzug. Hier kann ein Großteil der Raumluft in kurzer Zeit ausgewechselt werden. Zwar geht auch bei dieser Form der Fensterlüftung viel Wärme verloren, aber immerhin geschieht dies erst dann, wenn die Luft wirklich "verbraucht" (also in ihrer Qualität vermindert) ist. Nur wenig Luft wird erwärmt, ohne vor ihrer Nutzung schon wieder entlassen zu werden.
- Auf ähnlichem Niveau bewegen sich die Verluste bei Verwendung einer einfachen Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung. Beispielsweise kann es sich um eine reine Abluftanlage handeln, bei der verbrauchte Luft in manchen Räumen abgesaugt wird und die Frischluft über Lüftungsschlitze in anderen Räumen eintritt. Hier genügt eine geringere Frischluftmenge als bei unkontrollierter Belüftung, um eine gewisse Luftqualität aufrecht zu erhalten.
- Sehr viel geringer werden die Lüftungsverluste, wenn eine kontrollierte Lüftung über eine (zentrale oder dezentrale) Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung erfolgt. Hier wird die aus den Räumen abgesaugte Luft erst in einem Wärmeübertrager abgekühlt, bevor sie als Abluft ins Freie gelassen wird. Die gewonnene Wärme wird z. B. zur Vorwärmung der Frischluft verwendet. Wärmerückgewinnungsgrade über 90 % sind heute technisch möglich. Natürlich setzt die optimale Wirksamkeit einer solchen Anlage voraus, dass die Gebäudehülle hinreichend dicht ist, weil sonst zusätzlich eine unkontrollierte Belüftung erfolgt.
Höhe der Lüftungsverluste
Die Höhe der Energieverluste durch die Belüftung (Lüftungsverluste) hängt von zwei Faktoren ab: der ausgetauschten Luftmenge und dem Temperaturunterschied zwischen Zuluft und Abluft. Diese Verluste müssen während der Heizperiode zusätzlich von der Heizungsanlage ersetzt werden.
Die Wärmekapazität von Luft beträgt etwa 1,2 kJ/(m3 K). Man benötigt also 1,2 kJ, um einen Kubikmeter Luft um 1 K (ein Grad) zu erwärmen. Wenn eine Lüftungsanlage z. B. 200 m3 pro Stunde fördert und die Außentemperatur um 20 Grad tiefer liegt als die Raumtemperatur, würde dies ohne Wärmerückgewinnung einer verlorenen Heizleistung (Verlustleistung) von 20 K · 200 m3/h · 1,2 kJ/(m3 K) = 4,8 MJ/h = 1,33 kW entsprechen. (Bei einer effizienten Ölheizung entspräche dies ca. 0,14 Liter Heizöl pro Stunde.) Diese Lüftungsverluste sind zwar gering im Vergleich zu den Transmissionswärmeverlusten (Verlusten durch Wärmeleitung) in einem ungedämmten Gebäude. Wenn jedoch eine gute Wärmedämmung eingesetzt wird, bleiben die Lüftungsverluste als ein sehr wesentlicher Faktor.
Die Lüftungsverluste können durch Wärmerückgewinnung in einer Lüftungsanlage (siehe oben) massiv reduziert werden. Bei modernen Anlagen sind sie häufig 80 bis 90 % geringer als nach der obigen Rechnung; selbst Reduktionen deutlich oberhalb von 90 % sind möglich, zumindest auf der kleinsten Leistungsstufe des Lüftungsgeräts. Hierdurch werden die Lüftungsverluste selbst im stark gedämmten Gebäude keinen sehr großen Einfluß mehr auf die Energiebilanz des Gebäudes haben.
Man beachte, dass der Luftaustausch nicht nur fühlbare Wärme transportiert, sondern wegen der Luftfeuchtigkeit auch latente Wärme. Häufig führt die Belüftung (ob kontrolliert oder unkontrolliert) im Winter zu einer starken Austrocknung, so dass eine Luftbefeuchtung nötig wird. Das hierbei nötige Verdampfen von Wasser benötigt wiederum Energie – im günstigsten Fall Raumwärme (zusätzliche Heizwärme), im ungünstigsten Falle sogar wertvolle elektrische Energie. Die effektiven Lüftungsverluste können hierdurch deutlich höher werden als in der obigen Rechnung ohne die Berücksichtigung von Luftfeuchtigkeit. Eine Lüftungsanlage, mit der nicht nur Wärmerückgewinnung, sondern auch die (teilweise) Rückgewinnung von Luftfeuchtigkeit möglich ist, lassen sich auch diese Verluste eliminieren oder wenigstens stark vermindern.
Besonders wesentlich sind Lüftungsverluste in den Räumen, die mit vielen Personen belegt sind – etwa Klassenzimmer, Vortragssäle und Seminarräume. Hier kommt es also ganz besonders auf Wärmerückgewinnung an.
Energieaufwand für eine Lüftungsanlage
Die Vermeidung von Lüftungsverlusten durch kontrollierte (mechanische) Lüftung bedingt andererseits einen gewissen Aufwand von meist elektrischer Energie für den Betrieb der Lüftungsanlage. Bei modernen Anlagen ist diese Betriebsenergie jedoch weitaus geringer als die eingesparten Lüftungsverluste und verschlechtert deswegen die gesamte Energiebilanz kaum.
Siehe auch: Belüftung von Gebäuden, Lüftungsanlage, Fensterlüftung, Wärme, Energiebilanz eines Gebäudes
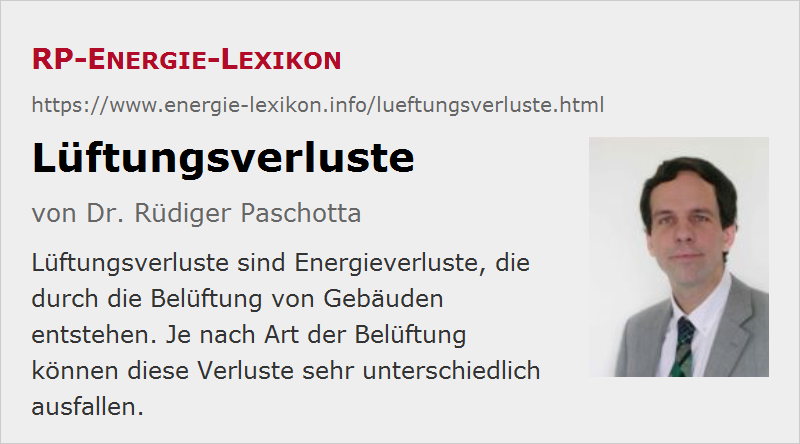
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!