Wärmedämmperimeter
Definition: die das beheizte Volumen eines Gebäudes umfassende Fläche, an der die Wärmeleitung am meisten behindert wird
Kategorien: Energieeffizienz, Grundbegriffe, Haustechnik, Wärme und Kälte
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta
Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen
Ursprüngliche Erstellung: 28.10.2012; letzte Änderung: 05.07.2025
URL: https://www.energie-lexikon.info/waermedaemmperimeter.html
Der Wärmedämmperimeter bezeichnet die das beheizte Volumen eines Gebäudes umfassende Fläche, an der die Wärmeleitung am meisten behindert wird. Er wird bei der Planung festgelegt, indem man die Wärmedämmung an den entsprechenden Orten platziert.
Beispiele hierfür:
- Wenn eine Außenwand eine äußere Wärmedämmung hat (→ Wärmedämmverbundsystem), liegt der Wärmedämmperimeter in dieser Dämmung (oder je nach genauer Definition auch an der Außenseite des Nutzvolumens). Die gemauerte Wand befindet sich dann also innerhalb des Wärmedämmperimeters, und Wärmebrücken sind relativ leicht vermeidbar.
- Wenn ein Hausdach nicht wärmegedämmt ist, dafür aber der Boden des Raums darunter, dann liegt der Wärmedämmperimeter in diesem Boden. Es wurde also die Entscheidung getroffen, den Dachboden außerhalb des Dämmperimeters zu platzieren. Dieser Raum wird dann im Winter kalt. Wenn dagegen der Raum unter dem Dach genutzt werden soll, verlegt man den Dämmperimeter über ihn, z. B. durch eine Dachsparrendämmung.
- Kellerräume liegen häufig außerhalb des Dämmperimeters; man bringt dann eine Kellerdeckendämmung an. (Wenn weder eine Deckendämmung noch eine Dämmung außerhalb des Kellers vorliegt, liegt kein klar definierter geschlossener Wärmedämmperimeter vor.) Es kann beim Neubau jedoch durchaus sinnvoll sein, die Kellerräume in das Innere des Dämmperimeters zu verlegen, indem man eine Dämmung unter dem Hausfundament platziert und die äußere Wärmedämmung bis auf das Fundament herunterzieht. Auf diese Weise werden Wärmebrücken unterbunden, die sonst schwer vermeidbar wären.
- Auch Treppenhäuser und Aufzugsanlagen sollten normalerweise innerhalb des Dämmperimeters liegen.
- Wenn Büroräume innerhalb einer großen unbeheizten Halle liegen, verlegt man den Wärmedämmperimeter an die Hülle um die Büroräume, weil sonst die zu dämmende Fläche viel größer würde.
Eine nachträgliche Änderung des Dämmperimeters ist im Prinzip möglich, aber schwieriger. Deswegen sollte der Dämmperimeter unbedingt bei der Planung nach diversen Kriterien (siehe unten) richtig gelegt werden.
Nur Räume innerhalb des Wärmedämmperimeters zählen zur Gebäudenutzfläche und Energiebezugsfläche des Gebäudes. Unbeheizte Nebenräume auch innerhalb des Dämmperimeters zählen nicht dazu; sie bleiben relativ warm, werden aber nicht direkt beheizt.
Naturgemäß treten die höchsten Temperaturdifferenzen im Winter gerade an der Wärmedämmung auf: Ihre Innenseite ist annähernd so warm wie der beheizte Innenraum, die Außenseite dagegen fast so kalt wie die Außenluft.
Kriterien für die Platzierung des Wärmedämmperimeters
Ein lückenlos geschlossener Wärmedämmperimeter ist eine Grundanforderung an ein gut zu beheizendes Gebäude. Im Einzelfall sind bei seiner Platzierung diverse Aspekte zu berücksichtigen:
- Ein wichtiges Kriterium ist, dass die zu dämmende Fläche möglichst klein wird im Verhältnis zum beheizten Volumen. Dies spricht z. B. dagegen, eine an das Haus angebaute Garage mit einzubeziehen, zumal diese weniger leicht nach außen dicht gestaltet werden kann.
- Andererseits sollen Wärmebrücken soweit wie möglich vermieden werden, was bei einem "größeren" Dämmperimeter meist einfacher zu erreichen ist. Beispielsweise liegt bei vielen Passivhäusern der Keller deswegen innerhalb des Dämmperimeters. Er wird zwar nicht beheizt, bleibt aber relativ warm.
- Verluste einer Heizungsanlage in einem Heizkeller tragen nur dann wesentlich zur Beheizung des Gebäudes bei, wenn der Heizkeller innerhalb des Dämmperimeters liegt. Allerdings sind diese Verluste bei modernen Heizungsanlagen so gering, dass dieser Aspekt bei der Planung kaum eine Rolle spielt.
- Wenn eine Wand innerhalb des Dämmperimeters liegt, trägt sie zum Wärmespeichervermögen des Gebäudes bei, also zur Verminderung von Temperaturschwankungen.
- Hinzu kommt, dass Räume außerhalb des Dämmperimeters viel eher Feuchteschäden erleiden bzw. die Vorbeugung dagegen aufwendiger ist. Es muss in diesem Sinne vermieden werden, dass Luft aus warmen Innenräumen in Räume außerhalb des Dämmperimeters gelangt, weil es dort sonst zu Kondensation kommen könnte. Wenn dagegen der Keller innerhalb des Dämmperimeters liegt, kann er kaum mehr feucht werden.
- Wenn ein Kellerraum später eventuell als Hobbyraum oder Gästezimmer beheizt werden soll, spricht dies ebenfalls für einen Dämmperimeter außerhalb dieses Raums.
- Ein großer Solarspeicher wird mit Vorteil innerhalb des Dämmperimeters platziert, da er in einer wärmen Umgebung weniger Wärmeverluste hat und die "Verluste" zudem zumindest in der Heizperiode zur Beheizung beitragen.
Siehe auch: Wärmedämmung, Wärmedämmverbundsystem, Wärmebrücke, Gebäudenutzfläche und Energiebezugsfläche
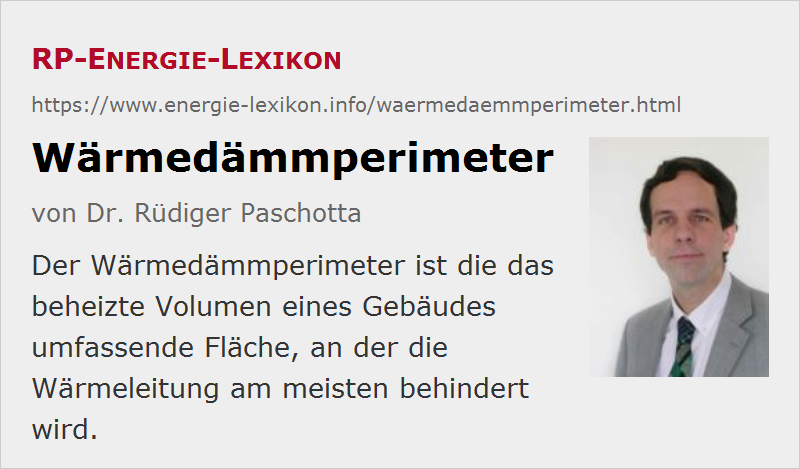
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!