Rollwiderstand
Definition: eine Reibungskraft, die beim Abrollen eines Rades entsteht
Englisch: roling resistance, roling drag
Kategorien: Fahrzeuge, Grundbegriffe
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta
Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen
Ursprüngliche Erstellung: 21.02.2016; letzte Änderung: 16.04.2025
Unter Rollwiderstand versteht man eine Reibungskraft, die beim Abrollen beispielsweise eines Rades entsteht und zum Fahrwiderstand beiträgt. Er kann mehrere Ursachen haben:
- Es gibt Reibung der Außenfläche des Rads mit dem Untergrund, etwa einem Straßenbelag.
- Zusätzlich können Reibungsverluste innerhalb eines Reifens auftreten, der durch den Anpressdruck verformt wird (Walkarbeit). Typischerweise ist der Rollwiderstand bei gut verformbaren Rädern, etwa mit Gummireifen, erheblich höher als bei harten Rädern wie Stahlrädern bei der Eisenbahn.
- Auch ein weicher oder unebener Untergrund kann die Reibung erheblich verstärken. Wenn etwa ein Reifen deutlich in den Untergrund einsinkt, entsteht eine wesentliche Reibung auch innerhalb des Untergrunds.
Natürlich tritt Reibung nicht nur an der Reifenoberfläche, sondern beispielsweise auch an Kugellagern auf; solche Beiträge sind bei Autos aber vergleichsweise gering. Weitere Reibungsverluste in einem Getriebe können eine erhebliche Rolle spielen, werden aber üblicherweise nicht zum Rollwiderstand gezählt.
Bei Autos und anderen Kraftfahrzeugen bringt der Luftwiderstand gewöhnlich den größeren Beitrag zu den gesamten Energieverlusten durch Reibung, außer bei niedrigen Fahrgeschwindigkeiten.
Größe des Rollwiderstands
Die Reibungskraft bei der Rollreibung kann mit der folgenden Formel gut abgeschätzt werden:
$$F_\textrm{R} = c_\textrm{R} F_\textrm{N}$$
Hierbei ist ($c_\textrm{R}$) der sogenannte Rollwiderstandskoeffizient, der von den Eigenschaften des Rades und denen des Belags abhängt, auf dem das Rad abgerollt wird.
Die Formel enthält außerdem die sogenannte Normalkraft ($F_\textrm{N}$), d. h. die Kraft, mit dem das Rad auf den Untergrund gedrückt wird. Bei einem Fahrzeug verteilt sich im Wesentlichen die Gewichtskraft auf die vier Reifen; an Steigungen wird die Normalkraft ein wenig reduziert (Multiplikation mit dem Kosinus des Steigungswinkels), da nur die Komponente der Gewichtskraft zielt, die senkrecht zum Untergrund wirkt.
Nach der genannten Formel (die die Realität gut annähert) ist der Rollwiderstand unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Dies bedeutet, dass beispielsweise auch die dadurch verursachten Energieverluste für 100 km Fahrstrecke nicht von der Fahrgeschwindigkeit abhängen. Dies im Gegensatz zum Luftwiderstand, der proportional zum Quadrat der Fahrgeschwindigkeit anwächst.
Rollwiderstand bei Autoreifen
Der Rollwiderstandskoeffizient von Autoreifen kann durch die Wahl des verwendeten Materials, die Gestaltung des Reifenprofils und durch andere Details der Fertigung beeinflusst werden. Hierbei gibt es allerdings diverse Zielkonflikte, da nicht nur der Rollwiderstand zu optimieren ist, sondern auch andere Eigenschaften wie die Straßenhaftung unter verschiedenen Umständen (etwa Regen und Schnee) und der Fahrkomfort. Typischerweise weisen Winterreifen einen deutlich höheren Rollwiderstandskoeffizienten auf als Sommerreifen. Da solche Werte für Laien wenig verständlich sind, werden Reifen heute in sogenannte Rollwiderstands-Effizienzklassen A bis G eingeteilt, die Vergleiche erleichtern sollen und auf Reifenlabels (zusammen mit Angaben über Nasshaftung und Geräuschemissionen) angezeigt werden.
Etwas verwirrend ist, dass z. B. in EU-Verordnungen Rollwiderstandskoeffizienten in Einheiten von kg/t (Kilogramm pro Tonne) angegeben sind. Multipliziert mit der Fahrzeugmasse in Tonnen erhält man damit einen Wert in Kilogramm – gemeint ist die Masse, deren Gewicht der Rollwiderstandskraft entspricht. Besser würde man statt z. B. 8 kg/t schreiben 8 · 10−3 = 0,008.
Bei Autoreifen hängt der Rollwiderstandskoeffizient auch erheblich vom Reifendruck ab: Er wird bei zunehmendem Reifendruck kleiner. Der Kraftstoffverbrauch kann deswegen durch einen gegenüber dem vom Hersteller empfohlenen Wert etwas erhöhten Reifendruck ein wenig reduziert werden, was allerdings einen verminderten Fahrkomfort zur Folge haben kann.
Nach EU-Verordnungen gibt es Kraftstoffeffizienzklassen für Reifen, wobei die Einstufung in eine Effizienzklasse zwischen A und G nicht nur vom Rollwiderstandskoeffizienten abhängt, sondern auch vom Reifentyp. Typ C1 steht für Autoreifen, und hier ist z. B. für die Effizienzklasse A ein Wert von maximal 0,0065 (= 6,5 kg/t) gefordert. In den Klassen C2 und C3 (für Lkw-Reifen) gelten hier die strengeren Grenzwerte von 0,0055 bzw. 0,004.
Der andere wichtige Faktor ist die Normalkraft, die im Wesentlichen durch die Gewichtskraft bestimmt wird. Ein schweres Fahrzeug hat deswegen unvermeidlich einen höheren Rollwiderstand als ein leichtes.
Für einen Autoreifen auf gewöhnlichem Asphaltbelag liegt der Rollwiderstandskoeffizient gewöhnlich zwischen 0,006 und 0,01. (Auf einem weichen Untergrund wie Erde oder Sand kann der Wert um ein Mehrfaches höher liegen.) Bei einer Fahrzeugmasse von 1000 kg (inklusive Beladung) entsteht auf ebener Fahrbahn eine Normalkraft von knapp 10 000 Newton, womit bei einem Rollwiderstandskoeffizienten von 0,01 eine Reibungskraft von ca. 100 N resultiert. Dies verursacht pro 100 km Fahrstrecke einen zusätzlichen Bedarf an Antriebsenergie von 100 N · 100 000 m = 10 MJ = 2,78 kWh (unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit). (Dasselbe würde eine Steigung der Fahrbahn von 1 % bewirken.) Im Falle eines Dieselmotors oder Benzinmotors mit 30 % Wirkungsgrad im Fahrbetrieb bedeutet dies einen zusätzlichen Kraftstoffverbrauch von knapp 1 Liter pro 100 km. Bei einer verdoppelten Fahrzeugmasse von 2000 kg wären es bereits 2 l / 100 km, und wenn zusätzlich ungünstige Breitreifen mit einem höheren Rollwiderstandskoeffizienten von 0,015 verwendet werden, geht es bereits um 3 l / 100 km. Die meisten heute verkauften Autoreifen liegen allerdings in den Effizienzklassen B und C, für die die Werte nur in einem Bereich der Breite 0,0024 variieren können, was bei 1,5 t Fahrzeugmasse einer Verbrauchsdifferenz von rund 0,4 l pro 100 km entspricht.
Im Falle eines VW Golf VII vergleichen wir im Folgenden die Beiträge von Rollwiderstand und Luftwiderstand:
- Bei einem Leergewicht von z. B. 1300 kg und einer Zuladung von 200 kg ergibt sich eine Normalkraft von ca. 15 000 N. Mit einem Rollwiderstandskoeffizienten von 0,01 ergibt das eine Rollreibungskraft von 150 N.
- Aus einer Stirnfläche von 2,19 m2 und dem cW-Wert von 0,27 ergibt sich für eine Fahrgeschwindigkeit von 100 km/h eine Luftwiderstandskraft von 274 N, also fast doppelt so viel wie der Rollwiderstand. Der Luftwiderstand sinkt für eine reduzierte Geschwindigkeit von 74 km/h auf 150 N. Bei einem Autobahntempo von 130 km/h steigt er dagegen auf 463 N an, was dann ca. drei Viertel des gesamten Fahrwiderstands ausmacht.
Bei Verwendung ungünstiger Reifen (z. B. Breitreifen) oder bei falscher Spureinstellung der Räder könnte der Rollwiderstand beispielsweise von 150 N auf 200 N ansteigen. Dies wäre der gleiche Effekt wie der einer Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit von 100 km/h auf 109 km/h.
Eine Erhöhung der Zuladung um 100 kg würde den Rollwiderstand um ca. 10 N vergrößern, entsprechend einer Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit von 100 km/h auf 102 km/h. Zusätzlich würde natürlich der Energieverbrauch beim Beschleunigen erhöht.
Für Eisenbahnräder auf Schienen liegen die Rollwiderstandskoeffizienten um eine Größenordnung tiefer als bei Reifen. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass die sehr steifen Räder und Schienen im Betrieb kaum eine Verformung erfahren, also praktisch keine Walkarbeit anfällt. Unter anderem deswegen ist Schienenverkehr selbst dann meist wesentlich energieeffizienter als Straßenverkehr, wenn die Masse der Fahrzeuge recht hoch ist.
Experimentelle Bestimmung des Rollwiderstands
Der Rollwiderstand und auch der Luftwiderstand eines Fahrzeugs kann beispielsweise mithilfe eines sogenannten Ausrollversuchs bestimmt werden. Näheres hierzu – auch über Manipulationen von Fahrzeugherstellern – enthält der Artikel über den Fahrwiderstand.
Siehe auch: Reibung, Fahrwiderstand
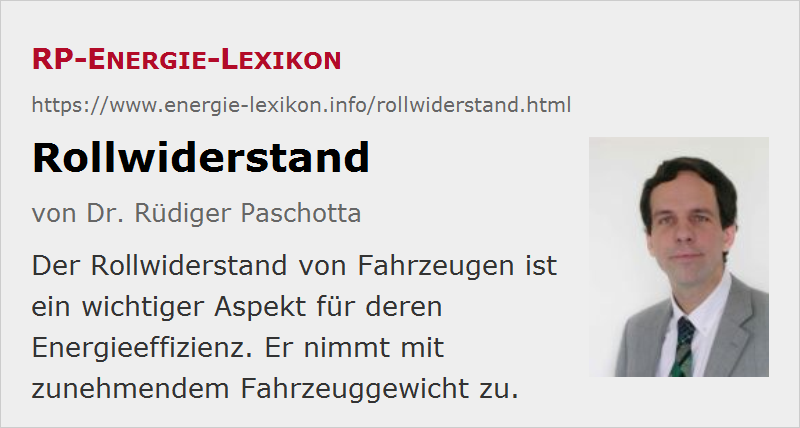
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!