Brauchwasserwärmepumpe
Definition: eine Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung
Allgemeiner Begriff: Wärmepumpe
Gegenbegriff: Heizungswärmepumpe
Englisch: hot water heat pump
Kategorien: Haustechnik, Wärme und Kälte
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta
Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen
Ursprüngliche Erstellung: 28.05.2010; letzte Änderung: 22.03.2025
URL: https://www.energie-lexikon.info/brauchwasserwaermepumpe.html
Eine Brauchwasserwärmepumpe ist eine Wärmepumpe, die speziell der Bereitung von Warmwasser dient. Der Begriff wird viel verwendet, ist aber leider etwas unscharf: Brauchwasser ist nämlich streng genommen Wasser, welches im Gegensatz zu Trinkwasser nicht für den menschlichen Genuss geeignet sein muss. In der Praxis wird fast immer Trinkwasser erwärmt – wobei dieses dann aber in aller Regel nicht für das Trinken genutzt wird, sondern vor allem für Reinigungszwecke. Aus hygienischen Gründen wird für das Trinken normalerweise kaltes Wasser bevorzugt – selbst wenn es beispielsweise für die Zubereitung von Tee oder Kaffee letztendlich erwärmt wird. Jedenfalls geht es aber nicht um Brauchwasser (oder genauer Betriebswasser), sondern um Trinkwasser.
Es ist zu empfehlen, statt Brauchwasserwärmepumpe den klareren Begriff Warmwasserwärmepumpe zu verwenden; siehe den entsprechenden Artikel.
Siehe auch: Warmwasserwärmepumpe, Wärmepumpe, Warmwasser, Warmwasserspeicher, bivalente und monovalente Anlagen
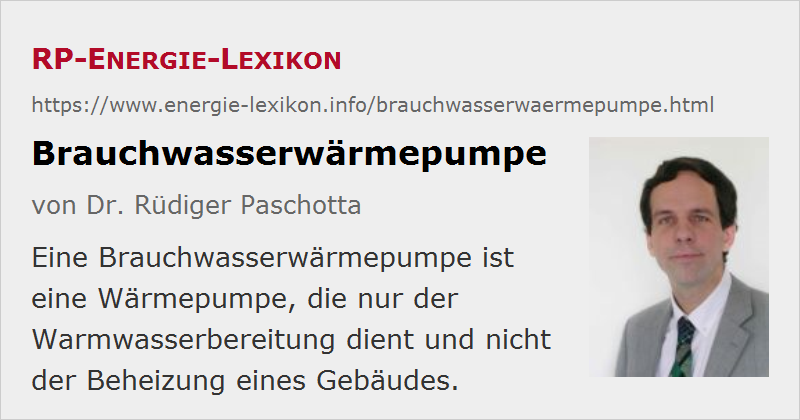
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!