Direktverbrauch
Definition: Verbrauch von Energie (meistens elektrischer Energie) nahe dem Ort der Erzeugung, ohne Durchleitung durch das öffentliche Stromnetz
Allgemeiner Begriff: Energieverbrauch
Gegenbegriff: Netzeinspeisung
Kategorie: elektrische Energie
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta
Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen
Ursprüngliche Erstellung: 24.07.2015; letzte Änderung: 16.04.2025
Der Begriff Direktverbrauch wird vor allem im Zusammenhang mit dezentral erzeugter elektrischer Energie (häufig aus Photovoltaikanlagen oder Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung) verwendet. Man meint damit Energie, die nahe am Ort ihrer Erzeugung verbraucht wird, und zwar ohne dass sie durch öffentliche Stromnetze geleitet wird. Anders als der Eigenverbrauch muss der Direktverbrauch nicht unbedingt durch den Betreiber der Stromerzeugungsanlage selbst erfolgen; es können beispielsweise auch Mieter beliefert werden (→ Mieterstrom).
Betriebswirtschaftliche Aspekte
Betriebswirtschaftlich kann es einen großen Unterschied machen, ob ein wesentlicher Teil dezentral erzeugter Energie dem Direktverbrauch dienen kann oder in das Netz eingespeist werden muss. Im letzteren Falle erhält der Betreiber nach dem deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetz nämlich lediglich die Einspeisevergütung, die heute selbst für Photovoltaikanlagen (außer für recht alte) erheblich niedriger ist als die typischen Stromtarife für den Bezug von Energie aus dem Netz. Diese Tarife enthalten nämlich auch Faktoren wie die Netznutzungsentgelte und die Stromsteuer, die wesentlich mehr als die eigentlichen Kosten der Stromerzeugung den Preis bestimmen. Die EEG-Umlage muss allerdings auch auf den Direktverbrauch bezahlt werden, soweit es sich nicht um Eigenverbrauch handelt.
Unter den genannten Umständen ist es für die Betreiber dezentraler stromerzeugender Anlagen vorteilhaft, wenn ein möglichst großer Teil der Erzeugung dem Direktverbrauch dienen kann. Die entsprechende Optimierung wird vorzugsweise auf organisatorischer Ebene vorgenommen; beispielsweise kann man sich darum bemühen, dass möglichst viele Mieter in einem großen Mehrfamilienhaus Mieterstrom aus einer lokalen Anlage beziehen. Technische Möglichkeiten für die Maximierung des Anteils des Direktverbrauchs sind dagegen meist nur sehr beschränkt einsetzbar. Besonders bei Photovoltaikanlagen kommen hierfür im Prinzip nur Solarstromspeicher infrage, die allerdings bis auf weiteres viel zu teuer sind, um die betriebswirtschaftliche Bilanz verbessern zu können. Eher gibt es Möglichkeiten bei Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung; hier kann eine erhöhte Leistung der Anlage in Verbindung mit einem Wärmespeicher eine Verlagerung der Stromerzeugung in die Zeiten erfolgen, in denen der Strombedarf am höchsten ist.
Energiewirtschaftliche Aspekte
Energiewirtschaftlich spielt es an sich keine große Rolle, ob dezentral erzeugte elektrische Energie direkt am Ort der Erzeugung verbraucht wird oder an einem womöglich ebenfalls sehr nahe gelegenen Ort, aber unter Verwendung des öffentlichen Stromnetzes (womöglich nur eines Verteilungsnetzes). Wenn beispielsweise ein einzelnes Wohngebäude in einer Straße über eine Photovoltaikanlage verfügt und zur Mittagszeit einen Überschuss an elektrischer Energie in das Netz einspeist, dürfte dieser im Wesentlichen in anderen Gebäuden in der gleichen Straße z. B. für den Betrieb von Elektroherden verbraucht werden. Dabei entsteht lediglich eine etwas andere (nicht unbedingt stärkere) Belastung des lokalen Verteilungsnetzes (und evtl. eine Entlastung der diesen Bereich aus der Ferne speisenden Leitungen).
Erst wenn viel größere Mengen von Energie in das Netz eingespeist werden, als lokal verbraucht werden können, wird es energiewirtschaftlich relevant, dass ein Energietransport über größere Distanzen nötig wird. Solche Entwicklungen kann man allerdings kaum durch eine Förderung des Direktverbrauchs dämpfen; ohnehin ist nicht klar, ob dies in jedem Fall sinnvoll wäre, da die volkswirtschaftlichen Kosten für Stromtransport wesentlich weniger bedeutsam sind als beispielsweise Kosten für die Installation von lokalen Energiespeichern.
Die genannten Umstände sind wesentlich für die Beurteilung mancher energiepolitischer Bestrebungen. Oft wird in der Vermehrung des Direktverbrauchs ein Schritt hin zur System- und Marktintegration der erneuerbaren Energien gesehen, und damit werden Methoden zur Förderung der Direktvermarktung gerechtfertigt. Ein Stück weit ist dies nachvollziehbar, insbesondere durch entstehende betriebswirtschaftliche Anreize für die stärkere Orientierung der Stromerzeugung am Strombedarf (siehe oben). Allerdings könnten Anreize hierfür beispielsweise auch durch zeitabhängige Einspeisevergütungen geschaffen werden. Solche gibt es beispielsweise in Dänemark bereits für die Einspeisungen von KWK-Anlagen.
Siehe auch: Eigenverbrauch, Einspeisevergütung, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Mieterstrom
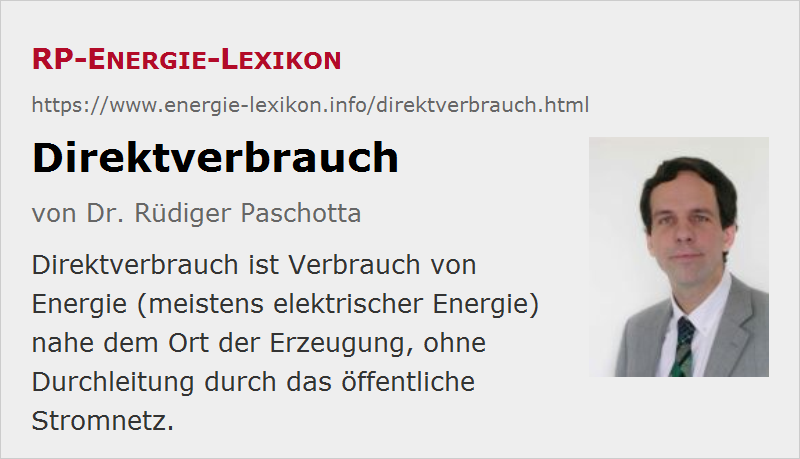
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!