Benzin
Definition: ein flüssiger Kraftstoff, hauptsächlich für Ottomotoren verwendet
Alternativer Begriff: Ottokraftstoff
Allgemeiner Begriff: fossiler Kraftstoff
Spezifischere Begriffe: Motorenbenzin, Flugbenzin, Normalbenzin, Superbenzin, Sommerbenzin, Winterbenzin, Gerätebenzin, Waschbenzin, Alkylatbenzin
Englisch: petrol, gasoline
Kategorien: Energieträger, Fahrzeuge, Kraftmaschinen und Kraftwerke
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta
Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen
Ursprüngliche Erstellung: 12.03.2010; letzte Änderung: 22.03.2025
Benzin ist ein flüssiger Kraftstoff, der hauptsächlich für den Betrieb von Ottomotoren verwendet wird (Motorenbenzin), in geringerem Umfang auch für diverse andere Zwecke, z. B. als Lösungsmittel. Der Begriff Ottokraftstoff ist nicht ganz präzise, da Ottomotoren auch mit anderen Kraftstoffen wie Ethanol oder Erdgas betrieben werden können.
Benzin ist im Wesentlichen ein Gemisch von relativ leichten Kohlenwasserstoffen. Es verdampft schon bei Zimmertemperatur leicht, ist leicht entzündlich (mit einem Flammpunkt unterhalb von −20 °C) und riecht relativ stark. Benzindämpfe sind giftig und krebserregend, unter anderem wegen ihres Gehalts an Benzol (= Benzen), welcher in der EU heute auf 1 % begrenzt ist. In der Industrie gelten für die Handhabung benzenhaltiger Flüssigkeiten strenge Sicherheitsvorschriften; an Tankstellen dagegen gelten diese nicht, und Benzin kann dort leicht verspritzt und eingeatmet werden, was erheblich gesundheitsgefährdend ist.
Der Heizwert von Benzin liegt bei ca. 41 MJ/kg, der Brennwert bei 43 MJ/kg; weitere Daten können der Tabelle rechts entnommen werden. Diese Werte hängen aber etwas von der Benzinsorte (siehe unten) ab.
Benzinsorten
Motorenbenzin wird an den Tankstellen in verschiedenen Sorten angeboten, die sich in verschiedener Hinsicht unterscheiden können:
- Ein wichtiges Merkmal ist die Oktanzahl (ROZ), welche die Klopffestigkeit angibt. Normalbenzin mit ROZ 91 wird kaum mehr verwendet, dagegen Superbenzin (in der Schweiz Bleifrei 95) mit ROZ 95 und Super plus (Bleifrei 98) mit ROZ 98. Benzinmotoren werden für Benzin mit einer gewissen Klopffestigkeit ausgelegt; wird diese nicht erreicht, kann der Motor durch intensives Klopfen Schaden nehmen. Wenige Motoren können sich mit Hilfe eines Klopfsensors automatisch auf verschiedene Oktanzahlen einstellen. Tendenziell sind mit höherer Oktanzahl höhere Motorleistungen und vor allem Wirkungsgrade möglich, aber nur wenn der Motor dafür ausgelegt ist, d. h. mit höherer Verdichtung arbeitet.
- Benzin kann eine Beimischung von Ethanol enthalten (häufig Bioethanol) – in Deutschland schon seit längerer Zeit bis zu 5 %. Die seit 2011 mit dem Zusatz "E10" angebotenen Sorten (z. B. "Super E10") enthalten einen Anteil von 10 % Bioethanol. Der Abschnitt "Beimischung von Ethanol" weiter unten gibt mehr Details zu diesem Thema.
- Verbleites Benzin enthält bleihaltige Zusätze (meist Bleitetraethyl) zwecks Erhöhung der Oktanzahl. Da es Abgaskatalysatoren schädigt und zu zusätzlichen giftigen Abgasemissionen führt, wird in der EU inzwischen nur noch bleifreies Benzin angeboten, außer bei Flugbenzin. Nur sehr alte Motoren verlieren durch Betrieb mit bleifreiem Benzin an Lebensdauer.
- Für Zweitaktmotoren wird Zweitaktgemisch, Benzin mit beigemischtem Schmieröl, verwendet.
- Für Kleingeräte wie Motorsägen und Rasenmäher wird oft spezielles Gerätebenzin verwendet (siehe unten), welches wesentlich weniger gesundheitsschädlich beim Einatmen der Abgase oder der Benzindämpfe ist. Es ist auch Zweitaktgemisch für Zweitaktmotoren erhältlich.
Die üblichen Sorten von Benzin sind gesundheitlich alles andere als unbedenklich. Besonders problematisch ist der häufig erhebliche Gehalt an Benzol, welches als krebserregend erkannt wurde. Ökologisch bedenklich sind nicht nur diverse Schadstoffe, die als Verbrennungsprodukte von Benzin auftreten, sondern auch sogenannte Verdunstungsemissionen, die vor allem bei der Betankung benzinbetriebener Fahrzeuge auftreten und teils auch beim Abstellen vor allem in der Sonne. Allerdings gibt es diverse technische Maßnahmen, um solche Verdunstungsemissionen zu minimieren.
Herstellung von Benzin
Die Herstellung von Benzin umfasst mehrere Schritte:
- Rohöl wird in diversen Ländern (z. B. im Nahen Osten und in Russland) gewonnen und in Tankern zu Erdölraffinerien transportiert, die meist näher bei den Verbrauchern liegen.
- In den Erdölraffinerien werden daraus diverse Produkte hergestellt, aber noch nicht die letztendlich verkauften Kraftstoffe. Außer der fraktionierten Destillation sind dort noch diverse andere Prozessschritte (z. B. Cracking, Isomerisierung und Reformierung) nötig.
- Benzin wird in Blending-Stationen aus Raffinerieprodukten abgemischt. Insbesondere werden diverse Additive (Zusätze) verwendet zwecks Vermeidung von Korrosion, Ablagerungen, Vergaservereisung und Dampfblasenbildung. Diese Abmischung kann je nach Kraftstoff-Marke etwas unterschiedlich sein, jedoch müssen die erzeugten Kraftstoffe staatlich gesetzten Normen entsprechen.
Bei der Benzinherstellung aus konventionell gewonnenem Erdöl (Erdölförderung, Transport und Raffinierung) entstehenden klimaschädlichen Emissionen betragen rund 10 % der CO2-Emissionen, die später durch Verbrennung des Benzins entstehen. (Der größte Teil dieser zusätzlichen Emissionen entsteht in der Raffinerie, der zweitgrößte bei der Rohölgewinnung; der Transport den Öltanker und fällt weniger stark ins Gewicht.) Der Energieverbrauch an Energie bei der Herstellung liegt sogar bei ca. 18 % des Energieinhalts des Kraftstoffs. Bei der Gewinnung von Erdöl mit nicht-konventionellen Methoden können Energieverbrauch und Emissionen allerdings noch weitaus höher sein.
Gerätebenzin ist ebenfalls ein Erdölprodukt, wird aber anders gewonnen: nicht durch Mischen verschiedener Destillationsfraktionen, sondern durch chemische Synthese aus Gasen, die bei der Destillation des Rohöls anfallen. Das Gerätebenzin besteht weitestgehend aus Alkanen (= Paraffinen) und enthält praktisch keine der krebserregenden Aromaten wie Benzen (= Benzol); es wird auch als Alkylatbenzin oder grünes Benzin bezeichnet. Deswegen ist seine Verwendung deutlich weniger gesundheitsgefährdend. Allerdings ist seine Herstellung erheblich aufwendiger und damit teurer.
Anderes synthetisches Benzin kann durch Kohleverflüssigung aus Kohle oder auch aus Erdgas gewonnen werden. In beiden Fällen geht ein wesentlicher Teil der Energie des primären Rohstoffs verloren. Im Falle der Kohleverflüssigung ist die Umweltbelastung massiv höher als bei der Benzinherstellung aus Erdöl, obwohl der erzeugte Kraftstoff in der Anwendung eher weniger umweltschädlich ist.
Beimischung von Ethanol
Benzin besteht weitgehend aus Erdölprodukten, aber es kann auch ein gewisser Anteil von Ethanol beigemischt werden – in der Regel sogenanntes Bioethanol, also aus Pflanzen gewonnener Ethanol-Alkohol. Dies wurde bereits während der Wirtschaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg praktiziert; damals verwendet man aus Kartoffeln gewonnenes Ethanol als sogenannten Kraftspiritus. Später wurde Ethanol für lange Zeit kaum mehr verwendet, aber in den letzten Jahren kam es zunehmend wieder zum Einsatz. Weit verbreitet ist eine Beimischung von 5 %, ohne dass der Kraftstoff entsprechend gekennzeichnet wird. Seit 2011 müssen die Tankstellen gemäß der EU-Biokraftstoffrichtlinie auch Benzinsorten mit dem Namenszusatz "E10" (z. B. "Super E10") anbieten, welche einen erhöhten Anteil von 10 % Bioethanol enthalten.
Die Bioethanol-Beimischung hat zunächst den Vorteil, dass weniger Erdöl benötigt wird, so dass die Abhängigkeit von den Erdölproduzenten entsprechend reduziert wird. Ebenfalls fallen die klimaschädlichen CO2-Emissionen etwas geringer aus. Allerdings ist der letztere Effekt ziemlich geringfügig, weil einerseits auch die Ethanol-Herstellung gewisse Emissionen und andere zusätzliche Umweltbelastungen verursacht (z. B. durch Pestizide, Landmaschinen und Brandrodungen) und andererseits der Kraftstoffverbrauch wegen des geringeren Heizwerts des Ethanols ein wenig erhöht wird. Man erhofft sich, dass der Ethanol-Anteil zu mindestens um 35 % niedrigeren CO2-Emissionen führt, was insgesamt also für den Kraftstoff nur wenige Prozente ausmacht. Trotz Vorschriften für die Nachhaltigkeit der Ethanolerzeugung bestehen Zweifel, ob z. B. tatsächlich die zusätzliche Schädigung von Regenwäldern verhindert werden kann. Es ist somit umstritten, in wieweit die Ethanol-Beimischung insgesamt gesehen ökologische Vorteile hat. Hinzu kommt, dass eine Konkurrenz mit dem Anbau von Lebensmitteln auftreten kann. Dies kann zu einer Erhöhung von Nahrungsmittelpreisen führen und damit den Hunger in der Welt verschärfen. Die Artikel über Biomasse und Biokraftstoffe enthalten hierzu weitere Details.
Die Klopffestigkeit des Kraftstoffs wird durch die Ethanolbeimischung erhöht, bzw. andere Zusätze für diesen Zweck (etwa Bleitetraethyl oder das krebserregende Benzen) werden weniger oder gar nicht mehr benötigt. Bei hohem Ethanolanteil (z. B. 85 % in E85) wird die Klopffestigkeit wesentlich höher als für gewöhnliche Benzinmotoren nötig. Das macht es möglich, Motoren mit deutlich höherem Verdichtungsverhältnis und entsprechend höherem Wirkungsgrad und höherer Leistung zu betreiben. Diese sind dann allerdings für den Benzinbetrieb nicht mehr geeignet.
Ein weiterer Vorteil von Ethanol-Beimischungen ist, dass die Abgase der Fahrzeuge weniger Kohlenmonoxid enthalten als bei reinem Benzinbetrieb.
Ein technisches Problem ist, dass E10 für viele ältere Fahrzeuge nicht geeignet ist, weil das Ethanol gewisse Materialien wie z. B. Naturgummi, PVC und Aluminium im Kraftstoffsystem angreifen und damit schwere Schäden verursachen kann (schon bei einmaligem Tanken). Fahrer solcher Fahrzeuge müssen also unbedingt Benzin mit geringerem oder keinem Ethanol-Anteil tanken. (Eine Umrüstung des Fahrzeugs dürfte kaum möglich oder lohnend sein.) Welche Fahrzeuge betroffen sind, kann man von den Autoherstellern oder von anderen Quellen wie der DAT [2] erfahren. Die Tankstellen sind an sich verpflichtet, weiterhin auch das normale Superbenzin anzubieten. Allerdings würde dies häufig die teure Einrichtung eines zusätzlichen Tanks und evtl. weiterer Zapfsäulen bedingen, weswegen häufig nur die Sorte "Super plus" mit geringerem Ethanol-Anteil angeboten wird. Somit werden viele Autofahrer gezwungen sein, das teurere "Super plus" zu tanken, obwohl die höhere Klopffestigkeit eigentlich gar nicht benötigt würde.
Ein weiteres technisches Problem kann auftreten, wenn das Benzin sehr kalt wird. Der Ethanolanteil neigt nämlich zur Aufnahme von Wasser, welches bei niedrigen Temperaturen dann aber wieder abgeschieden wird. Wenn ein solcher reiner Wasseranteil in genügender Menge vom Motor angesogen wird, kann der Motor ausgehen. Dies ist zwar ein im Straßenverkehr wohl sehr seltener Fall (weil es dafür zumindest in Mitteleuropa kaum je kalt genug wird), der zudem normalerweise kein ernstes Problem bedeuten sollte. Bei Verwendung als Flugbenzin in einem Propellerflugzeug ist ein Ausfall des Motors jedoch sicherheitstechnisch sehr problematisch.
Da der Heizwert des Benzins durch die Ethanol-Beimischung um knapp 2 % abnimmt, ist ein Kraftstoff-Mehrverbrauch von ca. 3,5 % bei Super E10 gegenüber reinem Superbenzin zu erwarten. Da nicht speziell gekennzeichnetes Benzin bereits 5 % Ethanol enthalten kann, dürfte der Unterschied allerdings eher nur knapp 2 % sein. Dies bedeutet, dass die Verwendung von Super E10 finanziell gesehen etwa gleich günstig ist, wenn der Preisunterschied knapp 2 % beträgt, was normalerweise auch der Fall ist.
Es besteht der Verdacht, dass für die energiepolitische Entscheidung zum vorgeschriebenen E10-Angebot die Interessen der Agrarwirtschaft eine gewichtigere Rolle gespielt haben als der geringfügige Klimaschutzeffekt, dem ohnehin auch ökologische Nachteile gegenüber stehen. Ebenfalls wurde die Ethanol-Beimischung von der deutschen Bundesregierung als Ersatz für eine entsprechend stärkere Verbrauchsreduktion bei Autos angesehen, was von der Autoindustrie unterstützt wurde. Somit wäre es im Falle einer Aufgabe oder Reduktion der Ethanol-Beimischungspflicht nötig, dass der Verbrauch von Neufahrzeugen doch stärker abgesenkt wird, um die gesetzten Klimaziele zu erreichen.
Ein gewisser politischer Druck in Richtung der Verminderung von Ethanolbeimischungen entsteht in Europa dadurch, dass die Erdölraffinerien zunehmende Benzinüberschüsse erzeugen, die ihre Wirtschaftlichkeit bedrohen. Dies ist nicht zuletzt auch eine Folge der steuerlichen Bevorzugung von Dieselkraftstoff.
Preise und Steuern
Benzin ist wie die meisten anderen Kraftstoffe in den meisten Ländern der Mineralölsteuer unterworfen, und zwar wesentlich stärker als z. B. Heizöl. Häufig liegt der Steueranteil am Benzinpreis weit über 50 %. Die Erlöse aus der Mineralölsteuer werden in der Regel zu einem gewissen Teil für Straßenbau und ähnliche Zwecke verwendet, teils aber auch für die allgemeine Finanzierung des Staates.
Vergleich mit Dieselkraftstoff
Der Artikel über Dieselkraftstoff enthält einen ausführlichen Vergleich von Diesel und Benzin.
Literatur
| [1] | Informationen über E10 vom Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, https://www.bmuv.de/faqs/e10 |
| [2] | E10-Verträglichkeit von Kraftfahrzeugen von der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, https://www.datgroup.com/de-at/informationen/e10-vertraeglichkeit-von-kraftfahrzeugen/ |
Siehe auch: Kraftstoff, Kohlenwasserstoffe, Benzol, Kraftstoff sparen, Vergaser, Kraftstoffeinspritzung, Flugbenzin, Ottomotor, Dieselkraftstoff, Bioethanol, Klopffestigkeit, Erdölraffinerie, Tanktourismus, Kohleverflüssigung, Mineralölsteuer, Verdunstungsemissionen
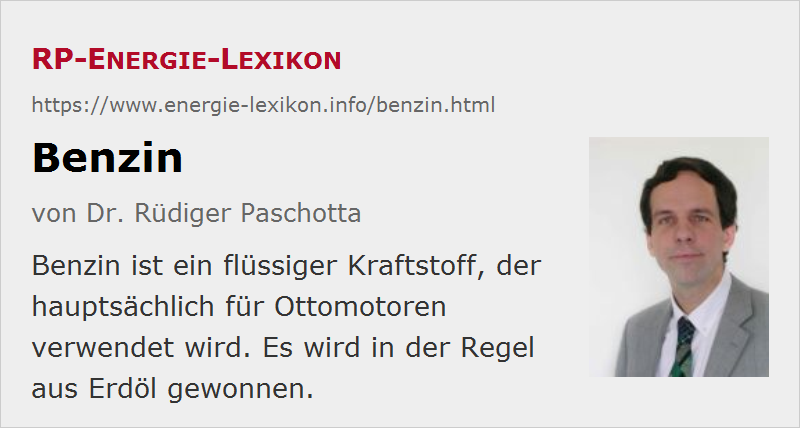
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!