Zurück zur Kernenergie
Erschienen am 13.03.2021 im RP-Energie-Blog (als E-Mail-Newsletter erhältlich!)
Permanente Adresse: https://www.energie-lexikon.info/rp-energie-blog_2021_03_13.html
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta, RP-Energie-Lexikon, RP Photonics AG
Inhalt: Die Abwendung der Klimakatastrophe muss die höchste Priorität haben, und die ökologischen Schäden durch Kernenergie sind bislang wesentlich geringer als die durch fossile Energieträger. Daraus folgt allerdings nicht, dass Klimaschutz durch Konzentration auf Kernenergie gelingen würde. Es muss klar sein, dass dies schon aus ökonomischen Gründen nicht möglich ist. Die drei Elemente der einzig praktikablen Strategie sind erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Suffizienz.

Die Einsicht, dass sich die eigentlich seit langem bekannten Klimagefahren zunehmend zeigen und wir angesichts der bislang völlig unzureichenden Bemühungen für Klimaschutz auf bestem Wege sind, in eine ausgewachsene Klimakatastrophe zu schlittern, verbreitet sich immer weiter. Zwar gibt es nach wie vor eine weit verbreitete Lethargie, jedoch verstehen immer mehr Menschen weltweit, was uns droht: nicht ein zeitlich genau definiertes katastrophales Ereignis, welches den raschen Untergang der Menschheit einleitet, sondern eine irgendwann nicht mehr aufhaltbare komplexe Entwicklung, bei der nach und nach verschiedene Grundlagen unseres Lebens (natürlich auch unseres Wohlstands) zusammenbrechen. Trotzdem steigen nach wie vor die globalen CO2-Emissionen. In Europa sinken sie zwar, aber viel zu langsam auf einem immer noch sehr hohen Niveau. Es liegt auf der Hand, dass dringend etwas geschehen muss, um das Ruder noch herumzureißen.
Der in Deutschland inzwischen in greifbarer Nähe liegende Atomausstieg scheint völlig quer dazu zu stehen: Ausgerechnet ein ziemlich CO2-armer Teil der Stromerzeugung fällt damit weg. Von daher ist es nachvollziehbar, dass einige nun fordern, der Verdrängung der fossilen Energieträger Priorität einzuräumen und die Kernenergie zumindest so lange weiter zu nutzen, bis das erreicht ist – je nach Sichtweise auch für lange Zeit. Auch international regt sich hier und da etwas in dieser Richtung – man denke an die Pläne von TerraPower (mit Bill Gates als bekannter Vertreter und Investor) und an gewisse "Ökomodernisten".
Da gibt es also wichtige Dinge zu diskutieren. Leider stößt man bei dieser Debatte immer wieder auf äußerst unseriöse und unfaire Beiträge – und zwar sowohl bei den Befürwortern wie auch bei den Gegnern der Kernenergie. Selbst wenn man noch so sehr überzeugt ist davon, das richtige Konzept gefunden zu haben, ist es nicht hilfreich, dieses mit unfairen Argumenten zu vertreten. An dieser Stelle möchte ich mit bestem Wissen und Gewissen diverse Argumente aufgreifen und unbefangen und fair bewerten.
Was spricht für die Kernenergie?
Zunächst einmal ist es einfach so, dass die Stromerzeugung mit Kernenergie zwar effektiv nicht völlig CO2-frei, aber doch immerhin sehr CO2-arm ist. Die durch Bau der Kraftwerke und Uranabbau sowie die ziemlich energieintensive Urananreicherung entstehenden Emissionen sind gewiss kein gutes Argument gegen die Atomenergie, da eine ähnliche Problematik z. B. bei Sonnenenergie und Windenergie besteht.
Ein wesentlicher Lösung Beitrag der Kernenergie ergäbe sich außerdem dadurch, dass Kernkraftwerke (zumindest die kommerziell etablierten Typen) relativ zuverlässig Strom liefern können, weitgehend unabhängig von den Wetterbedingungen – keine Sorge also vor Dunkelflauten, wodurch der Bedarf von Energiespeichern zumindest wesentlich geringer ausfiele als bei umfangreicher Nutzung von Sonnen- und Windenergie. Insofern ist zuzugestehen, dass eine Kilowattstunde aus Kernenergie energiewirtschaftlich deutlich wertvoller ist als eine aus den typischen erneuerbaren Energien. Dieser Aspekt muss bei der Kostenanalyse (siehe unten) natürlich angemessen berücksichtigt werden.
Günstig ist auch, dass weltweit genügend geeignete Standorte für Kernkraftwerke zur Verfügung stünden – anders als etwa bei der tiefen Geothermie, wo spezielle Verhältnisse des Untergrunds nötig sind, oder bei der Sonnenenergie, wo z. B. viele Standorte Norden kaum Erträge versprächen.
Ferner gibt es den Einwand, dass auch die Uranvorräte endlich sind und bei weiterer Nutzung auf dem derzeitigen Niveau in rund 130 Jahren erschöpft sein dürften. Und für einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz müsste diese Nutzung ja noch ganz massiv ausgeweitet werden. Auch das ist aber kein zwingender Einwand, da mit verbesserten Reaktortypen – sogenannten Brutreaktoren – das Uran weitaus besser genutzt werden könnte, womit riesige Mengen von Energie für Jahrtausende zur Verfügung stünden. Man merke sich aber, dass die breite Nutzung von Schnellen Brütern (und nicht etwa EPRs u. ä. wie in Finnland, Frankreich, China etc.) zwingende Voraussetzung für eine solche nukleare Klimastrategie wäre.
Kohleausstieg vs. Atomausstieg
Wenn man Deutschland betrachtet, kann man m. E. durchaus fragen, ob hier zumindest der Kohleausstieg nicht dringlicher gewesen wäre als der Atomausstieg. Zumindest bisher waren ja die Umweltauswirkungen der deutschen Kernkraftwerke marginal im Vergleich zu denen der Kohlekraftwerke. Allerdings schließt dies schwere Unfälle in der Zukunft nicht aus.
Das ist nun eine sehr schwierige Güterabwägung – mit einem Vergleich äußerst unterschiedlicher Risiken. Wir haben gesehen, dass die Katastrophe von Fukushima mit etwas weniger Glück ohne weiteres zur atomaren Verseuchung des ganzen Großraums Tokio hätte führen können, womit Japan weitgehend erledigt gewesen wäre. Nicht nur von den havarierten Reaktoren, sondern auch von den dort eingerichteten und stark gefüllten Brennelementelagern (Abklingbecken) gingen enorme Gefahren aus. Ein Brand eines solchen ungenügend geschützten und gekühlten Lagers hätte noch weitaus größere Mengen von Radioaktivität ausstoßen und mit geeigneten Windverhältnissen ohne weiteres auch bis Tokio schicken können. Von daher ist auch nachvollziehbar, dass eine große Mehrheit der Japaner nicht mehr bereit ist, diese Risiken weiter zu akzeptieren – auch wenn die Regierung weiterhin versucht, ihnen das aufzuzwingen.
Manche vertreten den Standpunkt, dass eben auch unnötige Fehler gemacht worden seien – etwa die unzureichende Auslegung der Reaktoren von Fukushima gegen starke Tsunamis und ein ungenügender Schutz der Abklingbecken –, und dass man es ja schließlich besser machen könne. Nun ist man hinterher eben immer schlauer. Vor der Fukushima-Katastrophe haben uns fast keine Experten davor gewarnt, dass hier etwas Schlimmes droht. (Interne Warnungen von Ingenieuren des Betreibers TEPCO gab es offenbar, aber diese wurden ignoriert und nicht öffentlich diskutiert.) Einen Tsunami als Auslöser können wir für deutsche Kraftwerke natürlich ausschließen, aber wer kann garantieren, dass alle realen Risiken wirklich vollständig und angemessen bewertet und berücksichtigt wurden? Etwa die eines terroristischen Angriffs, für den eine Vielzahl von Szenarien denkbar ist, aber eine vollständige Erfassung und perfekte Behandlung aller Möglichkeiten wohl kaum gelingen wird?
Maßgeblich ist hier natürlich nicht meine persönliche Meinung, sondern ob die Bevölkerung von Deutschland oder Japan noch überzeugt werden kann, diese Risiken weiter zu tragen. Wenn nicht, ist die nukleare Klimastrategie schon an diesem Punkt gescheitert. Wohlgemerkt braucht es beispielsweise auch in Frankreich nur noch einen einzigen massiven Unfall, und die dortige Bevölkerung wird sich genau gleich verhalten. Was ist das für eine Strategie, die mit einem einzigen Unfall scheitern kann?
Das Vertrauen in die Sicherheit der Kernenergie ist inzwischen in weiten Teilen der Welt stark beschädigt bis völlig zerstört, was auch kaum verwundern kann, nicht nur für die Einwohner Japans. Noch vor wenigen Jahrzehnten hieß es, ein Super-GAU sei praktisch nur theoretisch denkbar, zu erwarten höchstens einmal in mehreren Millionen Betriebsjahren eines Reaktors. Nach etlichen schweren Vorfällen glaubt das längst niemand mehr, jedenfalls für die bisherigen Reaktoren. Und ob dies für zukünftige Reaktoren (gar für Schnelle Brüter) völlig anders sein wird, muss man wohl bezweifeln.
Wäre die Klimakatastrophe nicht noch schlimmer?
Trotz allem kann man aber fragen, ob eine Klimakatastrophe – definitiv zu erwarten bei einer weiteren globalen Erwärmung um deutlich mehr als 2 °C – nicht noch viel schlimmer wäre, als gelegentlich mal in einer Weltregion einige tausend Quadratkilometer Land verseucht zu bekommen. Erscheint es auf der Hand zu liegen, dass die Klimakatastrophe in der Tat weitaus schlimmer wäre; praktisch niemand auf der Welt würde davon unberührt bleiben. Man denke allein an die unzähligen Millionen von Klimaflüchtlingen; die bisherige Flüchtlingsproblematik, die mit mehr gutem Willen immerhin noch gut bewältigbar sein sollte, würde davon bei weitem in den Schatten gestellt.
Die Gefahr dieser Art von Fragestellung besteht freilich darin, dass sie den Blick enorm verengt und damit zu völlig falschen Schlussfolgerungen führen kann:
- Zunächst einmal wäre zu klären, ob man durch Akzeptanz der nuklearen Risiken die Klimakatastrophe tatsächlich abwenden könnte – was ich schwer bezweifle (siehe unten).
- Außerdem sollte man natürlich immer, wenn man zwischen Teufel und Beelzebub auswählen soll, nach weiteren Optionen suchen, anstatt nur auf diese beiden zu starren.
Geht international etwas?
Gewisse Gruppen verkünden schon seit Jahren eine Renaissance der Kernenergie, entweder mit Hinweis auf tatsächliche Entwicklungen (etwa in Finnland, Frankreich, Großbritannien und China) oder als Zukunftshoffnung, auch mit dem Argument des Klimaschutzes. In der Wirklichkeit sieht es jedenfalls überhaupt nicht danach aus, als sei eine solche Renaissance zu erwarten oder gar bereits im Gange:
- Das Projekt Olkiluoto III in Finnland wird nicht wie von den französischen Erbauern erhofft der Auftakt für einen neuen nuklearen Höhenflug, sondern als ein Milliardendebakel vielmehr zu einer massiven Warnung für alle Interessenten weltweit.
- Ein zweites Debakel ganz ähnlicher Art mit dem gleichen Reaktortyp in Flamanville darf wohl als der Sargnagel dieser Hoffnungen betrachtet werden.
- Eine wichtige weitere (aber bislang wenig beachtete) Nachricht ist, dass in Frankreich die weitere Entwicklung des Schnellen Brüters (Projekt ASTRID) in 2019 aufgegeben wurde. Das zeigt wohl, dass man selbst in Frankreich nicht mehr an eine Zukunft dieser Technologie glaubt.
- In China werden zwar einige neue Reaktoren gebaut, wobei die Kosten offenbar deutlich besser im Griff gehalten werden, jedoch ist auch diese Entwicklung viel langsamer als von der Regierung geplant, während es mit den erneuerbaren Energien viel schneller vorangeht. Der Anteil der Kernenergie an der Energieversorgung bleibt deswegen auch in China auf absehbare Zeit ziemlich klein.
- Eine große Zahl von bereits sehr alten kommerziellen Kernreaktoren wird in den nächsten Jahren außer Betrieb gehen müssen, und es dürfte sehr schwierig werden, diese auch nur komplett zu ersetzen, geschweige denn die gesamte installierte Leistung. Noch wesentlich zu erhöhen.
Für Details konsultiere man den World Nuclear Industry Status Report 2020. Für Freunde der Kernenergie eine wahrlich ernüchternde Lektüre.
Somit wird klar, dass die Behauptung einer bereits stattfindenden Renaissance der Kernenergie eine völlig haltlose Propaganda ist. Als Zukunftshoffnung kann man natürlich dabei bleiben, allerdings wohl nicht ohne massive Zweifel an der tatsächlichen Realisierbarkeit.
Die Kosten der Kernenergie
Die Kernenergie wurde jahrzehntelang mit dem Argument vorangetrieben, sie sei als eine enorm billige Energiequelle wirtschaftlich unverzichtbar. Auch dieser Glaube ist allerdings inzwischen ganz gründlich erschüttert worden. Wie oben erwähnt, sind jedenfalls Neubauprojekte enorm teuer, nicht zuletzt wegen den nach den gemachten Erfahrungen erheblich verstärkten Sicherheitsvorschriften. Nur noch mit milliardenschweren staatlichen Subventionen sind solche Projekte überhaupt möglich – in Frankreich und den Vereinigten Staaten genauso wie in China. Hierin liegt wohl der Hauptgrund dafür, dass die viel beschworene Renaissance der Kernenergie überhaupt nicht in Gang kommt. Es ist gar nicht in erster Linie der Widerstand der verängstigten Bevölkerung, sondern die Unmöglichkeit, solche Kostenrisiken durch private Investoren tragen zu lassen, und die Schwierigkeit, die angeblich billige Energie vom Staat mit Milliarden zu subventionieren.
Nicht ganz fair ist allerdings ein einfacher Vergleich der entstehenden Stromkosten pro Kilowattstunde mit denselben Kosten bei Windenergie und Sonnenenergie (meist aus Photovoltaik). Es ist zu berücksichtigen, dass der Strom aus einem Park einiger Kernkraftwerke mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich zum größeren Teil jederzeit verfügbar ist, da der plötzliche unerwartete Ausfall eines Kernkraftwerks für Monate zwar durchaus gelegentlich vorkommt (z. B. 2005 in Leibstadt), aber eben nicht häufig. Zwar wäre eine bedarfsgerechte Lieferung von Leistung, etwa als Ergänzung für zeitweise Ausfall der erneuerbare Energie, noch besser, und dafür ist Kernenergie kaum geeignet. Jedoch sind die von ihr gelieferten Kilowattstunden immerhin wertvoller als diejenigen, die vom Wetter abhängig geliefert werden. Man muss also die höheren Kosten für zukünftig benötigte Energiespeicher den Erneuerbaren anrechnen, was ihren derzeit bereits sehr beachtlichen Kostenvorteil bei der Betrachtung der Kilowattstunden-Preise wieder deutlich relativiert. Man bedenke, dass dieses Problem in Zukunft deutlich stärker zum Tragen kommen wird, wenn der Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung erheblich wird.
Wichtig ist übrigens der Trend der Kosten. Bei der Kernenergie sehen wir einen Trend zu sehr starken Kostensteigerungen – mit regelmäßig viel höheren Baukosten als vorher veranschlagt. Gleichzeitig sind die Kosten der Erneuerbaren sehr stark gesunken und werden voraussichtlich immer noch weiter sinken. Ähnliches erwarte ich für Energiespeicher. Beispielsweise gibt es inzwischen recht ermutigende Entwicklungen bei den Batterien, was insbesondere für die Anwendung in Elektroautos wichtig ist. Wichtige, häufig übersehene Möglichkeiten bestehen außerdem im Ausbau der Stromnetze, die die verstärkte Nutzung längst bestehender Energiespeicher (etwa Wasser-Speicherkraftwerke in Norwegen) ermöglichen werden. Ein weiterer Ansatz ist verstärktes Lastmanagement; wir werden zukünftig vermutlich gewisse energieintensive Produktionen nicht nur vermehrt an günstigen Standorten für erneuerbare Energien sehen, sondern auch mit einer zeitlichen Anpassung der Produktion an das momentane Energieangebot. Dies könnte vielerorts kostengünstiger sein als die Errichtung großer Speicher.
Die Risiken der Endlagerung und der Atomwaffenverbreitung
Nochmals zurück zu den Risiken der Kernenergie. Die folgenden halte ich für noch schwerwiegender als die Betriebsrisiken der Reaktoren:
- Eine Lösung für die nukleare Endlagerung ist weltweit noch fast nirgends gefunden, trotz jahrzehntelanger Bemühungen. (Wenn es beispielsweise in Finnland als große Ausnahme Fortschritte gibt, lassen sich diese nicht ohne weiteres auf andere Länder übertragen.) In dieser Lage wäre es natürlich höchst problematisch, sogar eine massive Ausweitung der Atommüllproduktion als Preis für den Klimaschutz hinzunehmen.
- Leider hätte eine weltweite Ausweitung der Atomstromproduktion fast zwangsläufig zur Folge, dass die Gefahr der Weiterverbreitung von Atomwaffen und damit auch von Atomkriegen erheblich stiege. Daraus folgt für mich, dass wir dringend Lösungen entwickeln, demonstrieren und vorantreiben müssen, die ohne solche Gefahren global anwendbar sind. Wir lösen das Klimaproblem sicherlich nicht mit einer Spezial-Lösung für ein paar einzelne Länder, die man anderen Ländern aus Sicherheitsgründen verwehren muss.
Zwar wird hier und da behauptet, eine Lösung für das eine oder andere Problem sei doch verfügbar. Das meiste davon erweist sich allerdings als haltlose Propaganda:
- Es wird teils behauptet, man könne zukünftig Reaktoren bauen, die mit Atommüll betrieben werden, diesen dabei also beseitigen. Dahinter steckt nur ein Körnchen von Wahrheit: die theoretische Möglichkeit der Transmutation, die aber als umfassende Problemlösung auf absehbare Zeit vollkommen unrealistisch ist. Die Idee ist alt, aber wesentlich zur Problemlösung beigetragen hat sie noch nie.
- Es gibt durchaus Ansätze, die mit einem verringerten Risiko der Proliferation einhergehen, aber auch diese sind alles andere als perfekt – allein schon, weil Länder mit Ambitionen für Kernwaffen natürlich jeweils eine dafür geeignete Variante der Kernenergie aussuchen werden. Also ggf. möglichst mit Erzeugung von Plutonium, selbst wenn die Kostenproblematik absehbar fatal ist.
- Häufig haben wir auch die Situation, dass ein Ansatz zwar das eine Problem etwas entschärfen würde, ein anderes Problem dagegen eher noch verschärft. Natürlich bräuchte man eine umfassende Lösung für all diese Risiken, und die ist nach allem, was ich weiß, immer noch nirgends in Sicht.
Allerdings gehe ich davon aus, dass nicht die genannten Risiken, sondern zu allererst die Kostenproblematik die Renaissance der Kernkraft verhindert.
Fazit
Der eine oder andere mag finden, die nuklearen Risiken seien doch immerhin nicht so groß wie die einer Klimakatastrophe. Dafür spricht zwar einiges, zumindest solange wir dadurch nicht in Atomkriege laufen. Jedoch scheint es nach all den Jahrzehnten klar, dass wir die Klimakatastrophe unmöglich dadurch abwenden, dass wir nukleare Risiken in Kauf nehmen:
- Die Kosten sind für große Teile der Welt prohibitiv hoch. Vor allem deswegen kommt die Renaissance der Kernenergie überhaupt nicht voran. Das kann man je nach Standpunkt bedauern, aber anscheinend nicht ändern. Die Erneuerbaren kommen derweil auch in der Dritten Welt zunehmend voran.
- Man beachte, dass Kernenergie ohnehin nur im Strombereich einen gewissen Beitrag bringt. Ihr Beitrag zur global verbrauchten Primärenergie (inkl. Wärme, Verkehr, etc.) ist dagegen ziemlich marginal (derzeit ca. 5 %). Man bräuchte also nicht nur eine Beibehaltung der Kapazitäten, sondern eine massive Ausweitung mit tausenden neuer Reaktoren weltweit, um einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten zu können. Dies wohlgemerkt mit einem massiven Einstieg in Schnelle Brüter – eine Technologie, die trotz jahrzehntelanger milliardenschwerer Bemühungen noch nirgends kommerziell vernünftig funktioniert hat. Ohne dies würde uns aber das Uran vorzeitig ausgehen. Somit wird klar, dass eine solche Entwicklung extrem unrealistisch ist.
- Wir können auch nicht noch jahrzehntelang auf neue, hoffentlich bessere Entwicklungen warten (beispielsweise die Kernfusion), da uns beim Klimaschutz die Zeit davonläuft.
- Teils wird gesagt, wir müssten einfach alle Optionen zum Klimaschutz nutzen, um es noch rechtzeitig hinzu bekommen. Das ist falsch: Vielmehr müssen wir die begrenzten Ressourcen auf die Wege konzentrieren, die ernsthaft einen wesentlichen Beitrag zur Lösung versprechen. Konkret sehe ich hier nur eine Kombination dreier Wege: erneuerbare Energien, eine massiv verbesserte Energieeffizienz und auch Verzicht bzw. mehr Genügsamkeit (Suffizienz). Solche Lösungen, beispielsweise in Deutschland entwickelt und durch massiv gedrückte Kosten auch weltweit anwendbar, sind ein weitaus wertvoller Beitrag zum Klimaschutz als Spezial-Lösungen für einzelne Länder. (Ich wundere mich sehr, dass dieser global enorm wichtige Beitrag der deutschen Energiewende nicht mehr als eine Erfolgsgeschichte erkannt wird.)
- Dass die Energieeffizienz bislang nicht so stark gestiegen ist wie erhofft, hat den gleichen Grund wie der jahrzehntelang nicht erfolgte Kohleausstieg in Deutschland: fehlender politischer Wille. Wenn wir endlich eine angemessene CO2-Bepreisung (am besten wohl über eine CO2-Steuer) hätten, ginge da viel mehr.
- Die Kernenergie taugt auch nicht als Ergänzung zu den Erneuerbaren, da sie zumindest wirtschaftlich ungeeignet ist als Reserve für Dunkelflauten. Mit ihren hohen Investitionskosten müssen Kernkraftwerke so viele Jahresbetriebsstunden absolvieren wie möglich, und als Ergänzung dazu braucht man fossile Energien oder große Speicher. In der Praxis kommt die Reserve größtenteils aus fossiler Energie. Beispielsweise nutzt Frankreich vor allem im Winter deutsche Kohlekraftwerke.
- Übrigens würde Deutschland mit einer Wende rückwärts hin zur Kernenergie weltweit das schädliche Signal aussenden, mit Erneuerbaren allein ginge es nicht. Für all diejenigen Länder, für denen die Kernenergie schlicht schon zu teuer ist, hieße das mit anderen Worten, Klimaschutz ginge nicht. Das wäre wahrlich verheerend.
Aus all diesen Gründen warne ich dringend vor Versuchen, den Atomausstieg mit dem Argument des Klimaschutzes wieder infrage zu stellen. Dies mag gewissen Interessen dienen, dem Klimaschutz aber sicher nicht. Man könnte zwar mit dem Gedanken spielen, immerhin die bestehenden Kraftwerke noch etwas länger zu betreiben, um damit einiges an CO2 zu vermeiden. In der Praxis läuft dies aber in der Regel darauf hinaus, dass man alles andere vernachlässigt und mit dem Klimaschutz wieder nicht weiter kommt. Erst wenn Kohle- und Kernkraftwerke mit definitivem Termin herausgenommen werden, wird sich die Politik ernsthaft mit erneuerbaren Energien, Netzen und Speichern etc. befassen.
Dass wir die Kurve mit erneuerbaren Energien, Energiespeichern und Energieeffizienz noch rechtzeitig hinbekommen, ist alles andere als garantiert. Nach einer jahrzehntelangen Verschleppung des Problems wird es allmählich echt schwierig. Dass wir aber scheitern würden mit einer auf Kernenergie fokussierten Strategie, ist so gut wie sicher. Je länger man auf dieses tote Pferd setzt, desto länger vernachlässigt man echte Lösungen, für die dann zu wenig Aufmerksamkeit und Ressourcen zur Verfügung stehen. Man sieht dies auch am Beispiel Japan: Die Regierung will seit Jahren wieder mehr Kernenergie, bekommt dies aber nicht hin, und derweil werden wieder massenhaft fossile Energieträger genutzt. Dasselbe wird in Frankreich passieren, wenn es nur einen schweren Unfall dort gibt.
Wohlgemerkt ist diese zentrale Schlussfolgerung – Klimaschutz durch Kernenergie wird nicht funktionieren – nicht entscheidend davon abhängig, wie man persönlich gewisse Risiken bewertet. Beispielsweise sind nukleare Risiken durch Kernfusion-Reaktoren belanglos, solange diese mangels technischer Machbarkeit (und später vermutlich wegen der Kosten) ohnehin nicht gebaut werden können. Hören wir also endlich auf, uns mit ideologischen Kämpfen zu blockieren, und arbeiten wir an dem, was einzig eine Chance für die Abwendung der Klimakatastrophe bietet: an einer Kombination von erneuerbaren Energien (plus Energiespeicher, verstärkte Stromnetzen etc.), verbesserter Energieeffizienz und auch Einsparungen durch Verzicht. Der Anteil von letzterem wird umso größer werden müssen, je länger wir nur halbherzig an echten technologischen Lösungen arbeiten und stattdessen gar noch ein totes Pferd reiten.
Nachtrag vom 04.12.2021: Ein Diskussionsbeitrag der Scientists for Future kommt zu den gleichen Einschätzungen. Betont wird dort auch die Blockade der nötigen Transformationen durch das Festhalten an einer Technologie, die in Wirklichkeit keinen wesentlichen Lösungsbeitrag bringen kann, und diesen zu hohen Kosten und mit zusätzlichen Problemen.
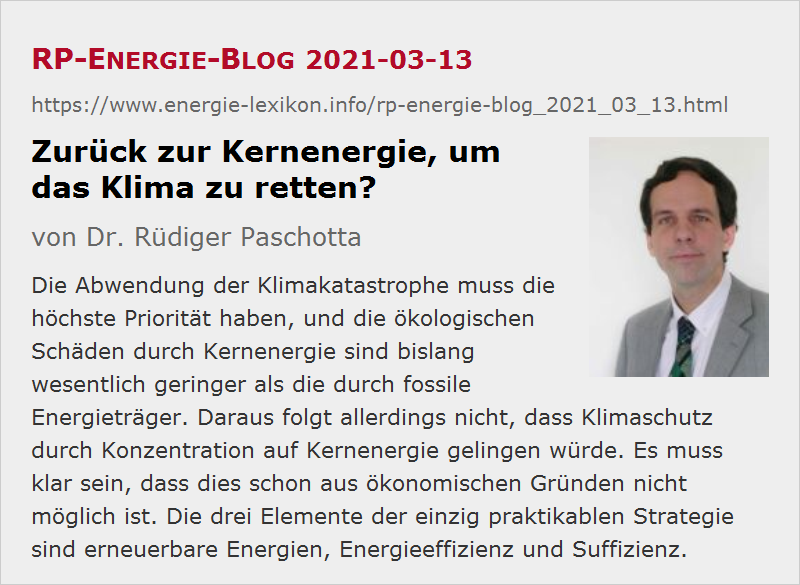
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!