Elektrische Spannung
Definition: die Energie pro Einheit transportierter elektrischer Ladung
Spezifischere Begriffe: Gleichspannung, Wechselspannung, Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung, Nennspannung, Bemessungsspannung, Netzspannung, Batteriespannung
Englisch: electrical voltage
Kategorien: elektrische Energie, Grundbegriffe, physikalische Grundlagen
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta
Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen
Einheit: Volt (V)
Formelsymbol: ($U$)
Ursprüngliche Erstellung: 11.09.2010; letzte Änderung: 16.04.2025
URL: https://www.energie-lexikon.info/elektrische_spannung.html
Die elektrische Spannung ($U$), die z. B. an einer Batterie oder einer Hochspannungsleitung anliegt, gibt an, wie viel Energie pro Einheit der elektrischen Ladung transportiert bzw. abgegeben wird. Die Maßeinheit für die Spannung ist das Volt (V); 1 Volt bedeutet ein Joule pro Coulomb (1 V = 1 J / C).
Mechanisches Modell
Manche Eigenschaften der Elektrizität können in einem mechanischen Gedankenmodell illustriert werden. Die in einer Leitung transportierten Ladungsmengen entsprechen in einem solchen Modell der Menge einer Flüssigkeit, die in einem Rohrsystem zirkuliert. Die elektrische Spannung z. B. zwischen hin- und zurückführender Leitung entspricht dann der Druckdifferenz zwischen den Leitungen. Auch im mechanischen Modell ist die transportierte Energie pro Volumeneinheit der Flüssigkeit gleich dem Druck bzw. Druckunterschied: ($W = p V$) in Analogie zu ($W = U Q$).
Spannung, Stromstärke und Leistung
Wenn an einer Steckdose oder an den Anschlussklemmen einer Batterie nichts angeschlossen ist, fließt kein elektrischer Strom; es ist also nicht angemessen zu sagen, da sei "Strom drauf". Es liegt jedoch trotzdem eine Spannung an. Wird ein elektrischer Verbraucher angeschlossen, so fließt ein Strom, dessen Stärke (Stromstärke) meist mit steigender Spannung zunimmt. Die Spannung treibt also sozusagen den Strom an, aber nur wenn die Verhältnisse einen Stromfluss zulassen. Die entstehende Stromstärke ergibt sich aus der Spannung dividiert durch den Widerstand des Verbrauchers.
Da Spannungsquellen in der Regel einen gewissen Innenwiderstand besitzen, sinkt ihre Spannung ab, wenn sie mit Strom belastet werden. Die höchste Stromstärke, der Kurzschlussstrom, tritt auf, wenn die beiden Leiter ohne nennenswerten Widerstand direkt miteinander verbunden werden, so dass die Spannung völlig zusammenbricht.
Die elektrische Leistung ergibt sich in jedem Moment aus dem Produkt von Spannung und Stromstärke. Bei sinusförmigem Wechselstrom ist die durchschnittlich transportierte Leistung gleich dem Produkt der Effektivwerte von Spannung und Strom sowie dem Kosinus des Phasenwinkels ($\cos \varphi$) (Verschiebungsfaktor) zwischen Spannung und Strom.
Spannung und elektrisches Potential
Eine elektrische Spannung kann man nicht für einen Leiter allein angeben, sondern immer nur als eine Spannung zwischen zwei Leitern. Man kann aber jedem Leiter ein elektrisches Potential zuordnen, sodass sich die Spannung zwischen zwei Leitern als die Differenz dieser Potentiale ergibt.
In der Praxis wählt man häufig ein bestimmtes Referenzpotential, bzw. einen Leiter, den man willkürlich das Potential null zuordnet. Das Potenzial jedes anderen Leiters entspricht dann der Spannung zwischen diesem Leiter und dem Referenzleiter. (Wenn gesagt wird, an einem bestimmten Leiter liege eine bestimmte Spannung, ist die Spannung zwischen ihm und dem Referenzleiter gemeint.) Häufig dient dabei das Erdreich als Referenzpotential, in anderen Fällen auch eine "Masseschiene" oder das elektrisch leitende Gehäuse eines Geräts.
Messung elektrischer Spannungen

Elektrische Spannungen zwischen zwei Leitern können mit einem Voltmeter gemessen werden. Dies ist ein Gerät, welches an beide Leitungen angeschlossen wird und die anliegende Spannung entweder analog (mit einem Zeiger) oder digital (als Zahlenwert) anzeigt. Hierbei wird die Spannungsquelle meist nicht nennenswert belastet, d. h. es wird nur ein sehr kleiner Strom durch das Messgerät fließen.
Gebräuchlich sind auch Multimeter (siehe Abbildung 1), die neben elektrischen Spannungen auch Stromstärken, Widerstände u. a. messen können.
Wechselspannungen; Spitzenwert und Effektivwert der Spannung
Bei Wechselspannungen (→ Wechselstrom) oszilliert die elektrische Spannung mit einer Frequenz von z. B. 50 Hz (d. h. 50 Schwingungen pro Sekunde). Wenn in einem solchen Fall "die" Spannung genannt wird, ist in der Regel ihr Effektivwert gemeint. Dieser beträgt ca. 70,7 % des Spitzenwerts. Beispielsweise beträgt der Spitzenwert bei einer 230-V-Steckdose ca. 325 V.
Nennspannung und Bemessungsspannung
Häufig findet man sogenannte Nennspannungen, die der Bezeichnung der Art eines Stromnetzes, einer Spannungsquelle oder eines Verbrauchers dienen, aber keine echte technische Spezifikation darstellen.
Etwas anderes bedeutet die Bemessungsspannung eines Betriebsmittels; das ist die vom Hersteller angegebene maximale Betriebsspannung, die dauerhaft erlaubt ist.
Typische Werte für elektrische Spannungen
Die Tabelle gibt typische Werte der elektrischen Spannungen in verschiedenen Zusammenhängen an.
| Beispiel | typische elektrische Spannung |
|---|---|
| Silizium-Solarzelle | 0,5 V |
| Batterie für Kleingeräte (eine Zelle) | 1,5 V |
| Autobatterie | 12 V |
| Haushaltssteckdose | 230 V |
| Oberleitung einer Bahntrasse | 15 kV |
| Hochspannungsleitung | 110 kV, 380 kV, 400 kV, 750 kV (HGÜ) |
Spannung bei Hochspannungsleitungen
Hochspannungsleitungen werden mit sehr hohen elektrischen Spannungen von z. B. 400 kV betrieben. Hierdurch werden relativ kleine Ladungsmengen benötigt, um große Energiemengen zu transportieren. Entsprechend sind die benötigten Stromstärken kleiner als bei einer Leitung, die mit niedrigerer Spannung die gleiche Leistung übertragen soll.
Gefährlichkeit hoher Spannungen
Hohe elektrische Spannungen von z. B. 100 V oder höher können für Menschen gefährlich sein. Wenn nämlich z. B. mit beiden Händen jeweils ein Pol einer Haushaltssteckdose berührt wird, treibt die Spannung von 230 V (Effektivwert) einen gefährlich hohen Wechselstrom durch den Körper an, der in diesem Fall durch die Herzgegend fließt und u. U. einen Herzstillstand durch Herzkammerflimmern verursachen kann.
Meist nicht gefährlich sind Spannungsquellen, die zwar eine sehr hohe Spannung erzeugen können, welche jedoch bei geringer Stromentnahme sofort zusammenbricht. Dies ist z. B. der Fall, wenn man in einem Raum mit sehr trockener Luft (geringer Luftfeuchtigkeit) über einen Kunstfaserteppich läuft. Hier können ohne Weiteres Spannungen von Dutzenden von Kilovolt (kV) entstehen, die beim folgenden Berühren eines Wasserhahns nur ganz kurzzeitig eine hohe Stromstärke und damit einen wohl unangenehmen, aber nicht gefährlichen elektrischen Schlag verursachen.
Ebenfalls ungefährlich ist es, beide Pole einer Spannungsquelle mit geringer Spannung (z. B. 12 V) zu berühren, selbst wenn diese durch angeschlossene Kabel einen sehr starken Strom schickt. Selbstverständlich sind hohe Stromstärken nur gefährlich, wenn sie durch den Körper fließen anstatt nur durch ein Kabel.
Trend zu höheren Spannungen
Der Übertragung elektrischer Energie gibt es in etlichen Sektoren einen Trend zur Verwendung höherer Spannungen, der praktisch immer dadurch motiviert ist, dass damit die für gewisse Leistungen notwendigen Stromstärken reduziert werden:
- Im großen Maßstab verwendet man zunehmend die Hochspannungs-Gleichstromübertragung (HGÜ), die oft noch wesentlich höhere Spannungen nutzt als die höchsten bei Drehstrom verwendeten Spannungen: z. B. 750 kV und teils sogar noch mehr.
- Für das Laden von Elektroautos sind höhere Spannungen günstig, um trotz nicht allzu dicker (damit auch leichterer und flexiblerer) Ladekabel geringe Ladezeiten zu erzielen. Derzeit wird an der 800-Volt-Technik gearbeitet, wobei auch das Batteriesystem dann für eine entsprechende Spannung ausgelegt wird.
- In Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor verwendete man bislang meist nur eine Spannungsebene mit 12 V (in Autos) oder 24 V (in Lastwagen). Für stärkere Verbraucher wie Klimaanlagen, vor allem aber für Elektromotoren und Generatoren selbst mit Mild-Hybridantrieben ist dies nicht mehr angemessen. Deswegen arbeitet man jetzt an der Einführung einer 48-Volt-Versorgung.
In Ländern wie den USA, in denen die Niederspannungsebene z. B. mit nur 120 V arbeitet, hätte eine Umstellung auf beispielsweise 230 V erhebliche Vorteile, beispielsweise für die Einführung von Elektroautos, die dann besser zu Hause geladen werden könnten. Jedoch ist dies wegen des enormen Aufwands praktisch unmöglich, vor allem weil dann ein Großteil der bislang verwendeten Geräte ausgetauscht oder aufwendig angepasst werden müsste.
Siehe auch: Volt, Nennspannung, Bemessungsspannung, Spannungsebene, Spannungsabfall, elektrische Energie, elektrische Stromstärke, Leistung, Effektivwert von Spannung und Stromstärke, Hochspannungsleitung
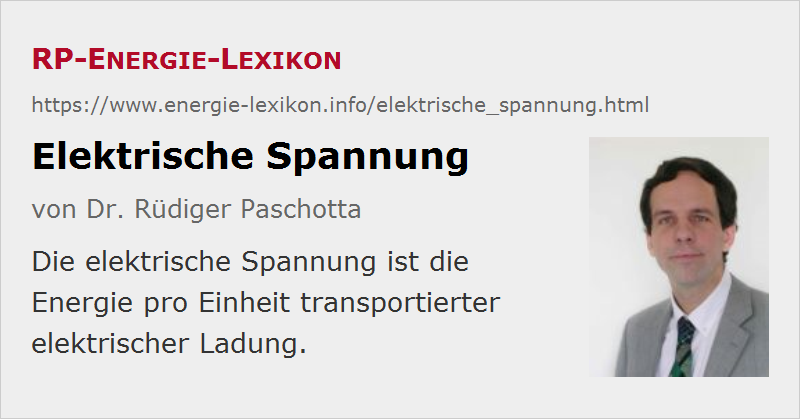
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!