Elektromotor
Definition: ein Motor, der mit elektrischer Energie arbeitet
Allgemeiner Begriff: Motor
Spezifischere Begriffe: Gleichstrommotor, Wechselstrommotor, Reihenschlussmotor, Permanentmagnetmotor, Linearmotor, Synchronmotor, Asynchronmotor, Kurzschlussläufermotor
Englisch: electric motor
Kategorien: elektrische Energie, Fahrzeuge
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta
Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen
Ursprüngliche Erstellung: 26.04.2010; letzte Änderung: 16.04.2025

Ein Elektromotor ist ein mit elektrischer Energie arbeitender Motor, d. h. eine Maschine, die elektrische Energie in mechanische Energie umwandelt. In den allermeisten Fällen geschieht dies mit Hilfe magnetischer Kräfte, die durch den Stromfluss in metallischen Leitern (oder manchmal in supraleitenden Materialien) entstehen, und nicht etwa durch elektrische Kräfte.
Bauarten von Elektromotoren
Für Elektromotoren gibt es eine sehr große Spanne verschiedener Bauarten mit entsprechend unterschiedlichen Eigenschaften. Hier sollen nur einige der grundlegendsten Unterscheidungen genannt werden:
- Die meisten Elektromotoren treiben eine rotierende Welle an, jedoch gibt es auch Linearmotoren.
- Manche Elektromotoren (vor allem kleinere) enthalten Dauermagnete (→ permanent erregte Motoren) und Elektromagnete, andere nur Elektromagnete. Die elektrische Erregung kostet zusätzliche Energie und liefert eher schwächere Magnetfelder, deswegen bei gleicher Baugröße ein geringeres Drehmoment und weniger Leistung, aber für große Motoren sind Permanentmagnete teuer.
- Manche Elektromotoren (vor allem kleinere) arbeiten mit Gleichstrom (Gleichstrommotor), andere mit Wechselstrom oder Drehstrom. Im letzteren Fall kann es entweder Wechselstrom mit einer festen Frequenz sein (meist für eine oder wenige feste Drehzahlen) oder mit einer variablen Frequenz (für variable Drehzahlen). Bei manchen Wechselstrommotoren müssen die Schwingungen des Wechsel- oder Drehstroms genau synchron zur Bewegung der Motorenachse sein (Synchronmotoren), bei anderen (Asynchronmotoren) dagegen tritt ein leichter Schlupf auf. In beiden Fällen besteht ein enger Zusammenhang zwischen der Drehzahl und der Netzfrequenz, der aber auch von der Polzahl des Motors beeinflusst wird. Es gibt aber auch Reihenschlussmotoren, bei denen die Drehzahl gar nicht an die Frequenz gekoppelt ist.
- Um Elektromagnete auf dem rotierenden Teil (Rotor) mit Strom zu versorgen, benötigt man Schleifkontakte, die häufig in viele kleinere Kontakte unterteilt sind und als Kommutator (d. h. zur periodischen Umkehrung der Stromrichtung) dienen. Häufig stellen dann Kohlebürsten den Kontakt her; sie sind Verschleißteile. Es gibt jedoch langlebigere bürstenlose Motoren, die keinerlei Schleifkontakte benötigen, da der Rotor nur Dauermagnete enthält oder da es sich um einen Kurzschlussläufermotor handelt.
Manche Bauarten wie Synchronmotoren sind erst durch die Entwicklung leistungsfähiger und effizienter Leistungselektronik breit einsetzbar geworden. Dies kommt z. B. der Entwicklung von Hybridantrieben und Elektroautos zugute. Für den Antrieb eines Elektroautos verwendet man typischerweise einen solchen Synchronmotor mit Permanentmagneten im Rotor und Kupferwicklungen im Stator, dazu ein Untersetzungsgetriebe (ohne umschaltbare Gänge), welches den Motor z. B. 5 mal schneller drehen lässt als die Radachse.
Anforderungen an Elektromotoren
Die große Zahl der Bauarten von Elektromotoren erklärt sich dadurch, dass je nach Anwendung sehr unterschiedliche Anforderungen gestellt werden:
- Es gibt Elektromotoren mit unterschiedlichsten Antriebsleistungen zwischen deutlich unter einem Watt und hunderten von Megawatt.
- Motoren werden mit sehr unterschiedlichen Drehzahlen und Drehmomenten betrieben, die im Betrieb entweder etwa konstant oder (ggf. sogar stark) variabel sind.
- Je nach Betriebsart und Bauweise kann der Wirkungsgrad stark variieren: von über 98 % bei großen Motoren bis unter 50 % bei billig gebauten oder ungünstig betriebenen kleinen Motoren.
- Die Bauform entscheidet darüber, ob ein Motor mit Gleichstrom, Wechselstrom oder Drehstrom arbeiten kann und ob er mit einer konstanten Betriebsspannung und -frequenz betrieben werden kann, oder ob Spannung und Frequenz z. B. der Drehzahl angepasst werden müssen.
- Viele Elektromotoren können umgekehrt auch als Generator dienen, d. h. sie können elektrische Energie liefern, wenn sie mechanisch angetrieben werden. Dies wird z. B. zur Rekuperation (Nutzbremsung) in Elektrofahrzeugen verwendet.
- Andere Aspekte sind die Lebensdauer, die Toleranz gegenüber zeitweiliger Überlastung, der Blindleistungsbedarf (bei Wechselstrommotoren) sowie die Geräuschentwicklung und Laufruhe.
Typische Anwendungen
Die Anwendungen für Elektromotoren sind extrem vielfältig:
- Diverse Fahrzeuge können elektrisch angetrieben werden, z. B. Elektrolokomotiven, Elektroautos, Gabelstapler. Soweit elektrische Energie nicht über eine Fahrleitung (wie bei Zügen üblich) zugeführt werden kann, muss ein Speicher mitgeführt werden, etwa eine aufladbare Batterie (Akkumulator).
- Vielerlei stationäre Maschinen und Geräte enthalten Elektromotoren, z. B. Produktionsmaschinen, Kühlschränke, Wärmepumpen, Umwälzpumpen von Zentralheizungsanlagen und diverse andere Pumpen.
- Für zahlreiche kleine und kleinste Antriebsanwendungen stehen passende Elektromotoren mit kleinen Abmessungen, geringem Gewicht und niedrigen Kosten zur Verfügung.
Für den elektrischen Energiebedarf im Haushalt besonders wichtig sind Elektromotoren in Heizungs-Umwälzpumpen, Ventilatoren von Lüftungsanlagen sowie Kompressormotoren in Kühl- und Gefriergeräten und Elektrowärmepumpen.
Typische Vorteile und Nachteile elektrischer Antriebe
Gegenüber Verbrennungsmotoren und anderen Wärmekraftmaschinen weisen Elektromotoren einige typische Vorteile auf:
- Besonders bei größeren Motoren sind sehr hohe Wirkungsgrade möglich. Bei Leistungen im Megawatt-Bereich werden oft 98–99 % erreicht, zumindest im optimalen Drehzahlbereich. Allerdings ist der Systemwirkungsgrad nicht unbedingt hoch, wenn die Stromerzeugung im Kraftwerk verlustreich ist.
- Ein hoher Wirkungsgrad ist häufig in einem großen Bereich von Antriebsleistungen und Drehzahlen möglich, und je nach Bedarf kann ein Elektromotor jederzeit problemlos an- und abgeschaltet werden. Beispielsweise erlaubt dies den sparsamen Betrieb von Elektroautos gerade auch im Stadtverkehr, wo Verbrennungsmotoren meist sehr unwirtschaftlich arbeiten.
- Ein weiterer Effizienzvorteil ergibt sich bei Fahrzeugen, wenn Bremsenergie zurückgewonnen werden kann (Rekuperation), um z. B. einen Akkumulator wieder aufzuladen oder Strom zurück in ein Netz einzuspeisen (wie bei Zügen üblich). Meist dient der Motor selbst dann als Generator. Selbst wenn die erzeugte elektrische Energie nicht zurückgewonnen werden kann, kann das elektrische Bremsen vorteilhaft sein, weil es eine zuverlässige und verschleißarme Lösung ermöglicht.
- Die Bauweise ist vor allem für kleinere Leistungen sehr kompakt.
- Die Geräuschentwicklung ist im Vergleich zu Verbrennungsmotoren meist sehr gering. Manche Elektromotoren laufen sogar fast unhörbar leise.
- Im Betrieb entstehen keine Abgase (außer in einer Wärmekraftmaschine, wenn damit die elektrische Energie erzeugt wird).
- Die Lebensdauer von Elektromotoren ist meist hoch, und meist wird wenig oder keine Wartung benötigt.
- Elektromotoren brauchen keine erhöhte Betriebstemperatur, haben also nicht die Kaltstartproblematik von Verbrennungsmotoren.
- Anders als Verbrennungsmotoren benötigen Elektromotoren keine Luftzufuhr – höchstens Kühlluft, die aber ggf. im Kreislauf geführt werden kann. Dies ist vorteilhaft z. B. für U-Boote.
Der wohl einzige erhebliche Nachteil von Elektromotoren ist, dass sie hochwertige elektrische Energie benötigen. Dies ist insbesondere bei mobilen Anwendungen wie Elektroautos ein Problem, da das Mitführen von Speichern für elektrische Energie erhebliche Nachteile aufweist im Vergleich zu Kraftstoffen als Speicher chemischer Energie. Aufladbare Batterien können pro Kilogramm weit weniger Energie speichern als ein Kraftstoff, und auch Brennstoffzellen haben bislang diverse Nachteile wie den Bedarf teurer Materialien und eine sehr eingeschränkte Auswahl von Kraftstoffen.
Energieeffizienz
Elektromotoren können sehr energieeffizient sein, jedoch werden die vorhandenen technischen Effizienzpotenziale häufig nicht ausgenutzt. Besonders mit Motoren, die im Dauerbetrieb eingesetzt werden, führt dies häufig zu einem unnötigen hohen Verbrauch an elektrischer Energie.
Einige häufig auftretende Probleme sind:
- Motoren mit ungünstigen veralteten Bauarten (z. B. Spaltpolmotoren) sind vielerorts noch im Einsatz. Mit modernen Motoren (z. B. Permanentmagnetmotoren) ließen sich oft mehr als 50 % der Energie einsparen.
- Motoren mit einer für die Anwendung unnötig hohen Leistung werden ausgewählt. Auch die Antriebsdrehzahl kann höher als notwendig gewählt sein.
- Motoren werden mit einer konstanten Drehzahl betrieben, anstatt dass die Drehzahl der jeweiligen Notwendigkeit angepasst wird. Dies ist besonders schädlich beispielsweise bei Heizungs-Umwälzpumpen, die bei warmem Wetter gegen geschlossene Thermostatventile ankämpfen (unnötig viel Druck aufbauen) und dann sogar mehr Leistung aufnehmen als im normalen Heizbetrieb.
Moderne, hocheffiziente Motoren haben häufig noch zusätzliche Vorteile, z. B. einen geringeren Blindstrombedarf, einen ruhigeren Lauf und eine längere Lebensdauer. Manche Vorteile hocheffizienter Motoren resultieren aus einer aufwendigeren Bauweise des Motors selbst (z. B. mit mehr Kupfer oder mit starken Permanentmagneten), andere aus zusätzlichen Einrichtungen wie z. B. effizienten Umrichtern und Regelungen.
Mangels Information wird selbst bei industriellen Anwendungen, wo ein besserer Motor die Mehrkosten häufig innerhalb weniger Jahre (also einem Bruchteil der Lebensdauer) amortisieren könnte, ein solcher häufig nicht eingesetzt. Es sind Bemühungen von staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen im Gange, solche Informationslücken zu schließen. Ein Mittel hierzu sind möglichst international einheitlich definierte Effizienzklassen für Motoren, wie z. B. die seit 2008 harmonisierten Klassen IE3-Stern, IE2-Stern und IE1-Stern.
Anlaufstrom
Elektromotoren weisen beim Einschalten häufig eine sehr hohe Stromaufnahme auf, bis sie ihre Drehzahl erreicht haben. (Der Grund hierfür liegt im Wesentlichen an einer noch fehlenden induzierten Gegenspannung, wobei die Details stark von der Bauart des Motors abhängen.) Dieser Anlaufstrom (oder Einschaltstrom) muss oft durch geeignete Maßnahmen begrenzt werden, beispielsweise um das Stromnetz nicht zu überlasten und nicht andere Verbraucher in ihrer Funktion zu stören. Eine Möglichkeit besteht darin, einen Sanftanlauf mithilfe geeigneter Elektronik zu realisieren.
Literatur
Siehe auch: elektrische Energie, mechanische Energie, Motor, Elektroauto
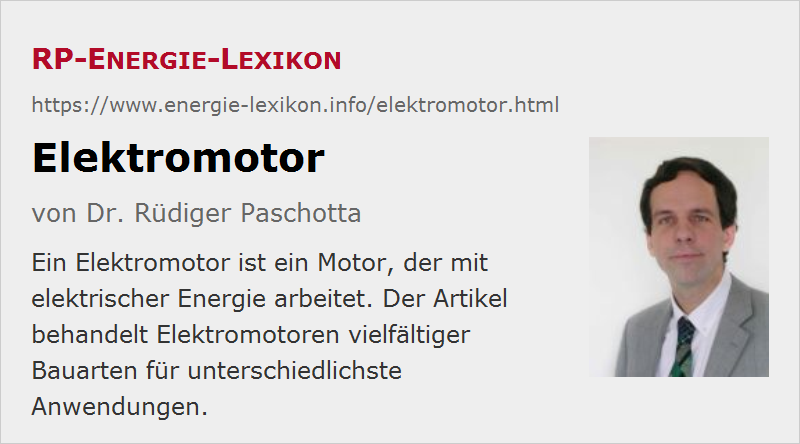
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!