Energiebilanz eines Gebäudes
Definition: eine summarische Betrachtung von Energieströmen, und zwar meist Wärmeströmen
Englisch: energy balance of a building
Kategorien: Energieeffizienz, Haustechnik
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta
Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen
Ursprüngliche Erstellung: 07.03.2015; letzte Änderung: 16.04.2025
URL: https://www.energie-lexikon.info/energiebilanz_eines_gebaeudes.html
Die Energiebilanz eines Gebäudes betrifft in aller Regel die Wärmemengen, die das Gebäude auf verschiedenen Wegen verlassen bzw. in das Gebäude eingebracht werden. Obwohl auch Energiebilanzen beispielsweise für elektrische Energie erstellt werden können, befasst sich dieser Artikel nur mit der Wärmebilanz.
Wegen des grundlegenden Prinzips der Energieerhaltung muss die Energiebilanz eines Gebäudes im Mittel ausgeglichen sein, d. h. es wird bei Betrachtung einer längeren Zeitperiode (z. B. mehrere Tage) genau so viel Wärme das Gebäude verlassen, wie insgesamt in das Gebäude eingebracht wird. Andernfalls müsste sich nämlich der Wärmeinhalt und damit auch die mittlere Temperatur des Gebäudes ändern. Wenn die Differenz von Wärmeabflüssen und -zuflüssen z. B. innerhalb eines Monats auch nur 1 % der gesamten Wärmezufuhr betrüge, würde dies bereits zu einer sehr starken Temperaturänderung des Gebäudes führen.
Innerhalb einzelner Stunden muss die Wärmebilanz eines Gebäudes allerdings nicht ausgeglichen sein. Oft schwankt nämlich die Temperatur im Gebäude in einem tageszeitlichen Rhythmus, beispielsweise durch starke Sonneneinstrahlung zur Mittagszeit und als Folge der Nachtabsenkung der Heizungsanlage.
Häufig wird fälschlich davon ausgegangen, dass das Wärmespeichervermögen eines Gebäudes für dessen Energiebilanz von wesentlicher Bedeutung sei. Zwar kann es durchaus nützlich sein, wenn das Wärmespeichervermögen die Ausschläge der Innentemperatur etwa bei kurzzeitig starker Sonneneinstrahlung dämpft. Jedoch bleibt die längerfristige Energiebilanz davon weitgehend unberührt. Dies im Kern deswegen, weil ein Wärmespeicher im Mittel nur so viel Wärme abgeben kann, wie er zu anderen Zeiten aufgenommen hat.
Es muss definiert werden, was für die Energiebilanz genau zum Gebäude zählt. Sinnvollerweise zählt man hierzu alles, was innerhalb des Wärmedämmperimeters liegt. Das bedeutet beispielsweise, dass unbeheizte Kellerräume in der Regel nicht dazugehören, außer wenn die Wärmedämmung unter diesen Räumen liegt.
Übersicht über die Wärmezuflüsse und -abflüsse
Wärme kann im Wesentlichen über die folgenden Mechanismen in ein Gebäude gelangen:
- Mithilfe einer Heizungsanlage kann Heizwärme gezielt in ein Gebäude eingebracht werden, z. B. durch Heizkörper oder eine Fußbodenheizung.
- Außerdem gibt es diverse innere Wärmequellen, die innere Wärmegewinne (oder interne Wärmegewinne) ergeben. Beispielsweise geben Personen ständig Wärme an ein Gebäude ab; für eine erwachsene Person, die sich nicht allzu kräftezehrend bewegt, liegt die zugeführte Wärmeleistung bei rund 100 W, was 2,4 kWh pro Tag ergibt. Hinzu kommt die Wärmeabgabe diverser Geräte. Die von diversen Geräten (auch von Beleuchtungseinrichtungen) verbrauchte elektrische Energie verbleibt oft vollständig als Wärme im Gebäude, soweit sie nicht direkt ins Freie gelangen kann. Beispielsweise kann aufsteigende Warmluft über einem Kochherd über eine Abluftvorrichtung verloren gehen, und bei einer Waschmaschine oder Geschirrspülmaschine kann ein wesentlicher Teil der erzeugten Wärme über das Abwasser entweichen. Auch Wärme, die außerhalb des Wärmedämmperimeters (beispielsweise in unbeheizten Kellerräumen) entsteht, geht oft weitgehend verloren.
- Hinzu kommen sogenannte solare Gewinne, die hauptsächlich entstehen, indem Strahlung der Sonne durch Fenster in Räume eindringt und dort in Wärme umgewandelt wird.
Auf der anderen Seite kann Wärme vor allem auf die folgenden Weisen entweichen:
- Jedes Gebäude weist gewisse Transmissionswärmeverluste auf: Wärme entweicht durch den Mechanismus der Wärmeleitung nach außen, solange die Außentemperatur niedriger liegt als die Innentemperatur. Solche Wärmeverluste lassen sich durch eine effektive Wärmedämmung (z. B. an Fassaden, beim Dach und an Kellerdecken) stark reduzieren.
- Hinzu kommen Lüftungsverluste: Wärme wird durch Luft, die als Kaltluft eindringt und in erwärmter Form wieder austritt, nach außen befördert. Dies kann einerseits durch die in aller Regel unverzichtbare Belüftung geschehen, andererseits aber auch durch unkontrollierte Undichtigkeiten. Die Höhe der Lüftungsverluste hängt in vielen Fällen nur davon ab, wie viel Luft insgesamt pro Tag ein Gebäude durchströmt, und wie hoch die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen ist. Allerdings können die Lüftungsverluste stark (z. B. um einen Faktor 5 bis 10) reduziert werden, indem man eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einsetzt; hier wird in der Regel der Abluft Wärme entnommen, die für die Erwärmung der Zuluft verwendet wird. Man beachte außerdem, dass die für die Belüftung notwendige Luftmenge stark davon abhängt, wie gezielt und kontrolliert die Frischluft eingebracht wird. Im Idealfall wird durch eine Anlage für die kontrollierte Belüftung die Frischluft beispielsweise in Wohnzimmer und Schlafzimmer eingebracht, strömt von dort ausschließlich in Küchen und Badezimmer, wo dann die Abluft abgezogen wird. Hier erfolgt eine sogenannte Kaskadennutzung.
- In meist geringerem Umfang erfolgen Wärmeverluste über das Wasser. Leitungswasser gelangt kalt in ein Gebäude, während das entstehende Abwasser oft erhebliche Wärmemengen mit sich trägt.
- Wenn ein Gebäude über eine Klimaanlage mit einem Kälteaggregat verfügt, kann damit dem Gebäude eine gewisse Wärmeleistung entzogen werden.
Bestimmung des Heizwärmebedarfs
In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass die Innentemperatur eines Gebäudes während der Heizperiode etwa konstant gehalten wird (z. B. auf 20 °C). Dies bedeutet, dass die Energiebilanz z. B. über 24 Stunden ziemlich genau ausgeglichen sein muss.
Die Wärmeverluste ergeben sich wie oben gezeigt im Wesentlichen durch die Summe von Transmissionswärmeverlusten und Lüftungsverlusten, die beide in der Regel proportional zur Temperaturdifferenz zwischen innen und außen sind. Auf der anderen Seite entstehen praktisch immer gewisse innere Wärmegewinne und solare Gewinne, die in der Summe an kalten Tagen allerdings häufig deutlich kleiner sind als die Summe der Wärmeverluste. Die Wärmebilanz muss also durch Zufuhr von Heizwärme ausgeglichen werden, deren Menge sich als die Summe aller Wärmeabflüsse abzüglich der inneren und solaren Gewinne ergibt.
Die quantitativen Verhältnisse beispielsweise für ein Einfamilienhaus an einem frostigen, aber sonnigen Wintertag hängen nun sehr stark v. a. von der Bauweise des Hauses ab:
- Bei einem älteren Haus ohne besondere Wärmedämmung können die Transmissionswärmeverluste ohne Weiteres z. B. 300 kWh (pro Tag) betragen. Hinzu kommen Lüftungsverluste von z. B. 25 kWh. Auf der anderen Seite entstehen durch drei durchschnittlich im Haus befindliche Bewohner und durch die Geräte innere Wärmegewinne von z. B. 15 kWh, und die Sonneneinstrahlung durch die Fenster könnte 30 kWh beitragen. Es ergibt sich also ein Heizwärmebedarf von 280 kWh pro Tag. (Vernachlässigt wurden wenige Kilowattstunden, die über das Abwasser verloren gehen.) Man erkennt, dass die Transmissionswärmeverluste stark dominierend sind.
- Wäre das Haus mit einer effektiven Wärmedämmung beispielsweise in Form eines Wärmedämmverbundsystem ausgestattet, könnten die Transmissionswärmeverluste z. B. auf 100 kWh sinken. Wenn die anderen Zahlen unverändert bleiben, sinkt damit der Heizwärmebedarf um 200 kWh auf 80 kWh.
- Man erkennt, dass eine weitere Verringerung der Wärmeverluste um 80 kWh die Heizwärmezufuhr komplett unnötig machen würde. Zwar wird man die Transmissionswärmeverluste kaum von 100 kWh auf 20 kWh absenken können, da der technische Aufwand für eine nochmals so stark verbesserte Wärmedämmung unverhältnismäßig hoch wäre. Jedoch gibt es auch noch einen Spielraum bei den Lüftungsverlusten, der durch die Wärmerückgewinnung mit einer Lüftungsanlage genutzt werden kann. Außerdem kann man die solaren Gewinne optimieren, indem man auf der Südseite großzügige Fensterflächen vorsieht und das Haus nach Möglichkeit optimal auf die Sonne ausrichtet. Insgesamt ist es durchaus möglich, eine ausgeglichene Energiebilanz auch ohne Zufuhr von Heizwärme an den meisten Tagen zu erzielen, wenn das Einfamilienhaus technisch optimal gestaltet wird. Es kann dann auf eine reguläre Heizungsanlage verzichtet werden, da nur noch eine Art Notheizung für besonders ungünstige (sehr kalte und gleichzeitig trübe) Tage benötigt wird. Dies ist das Konzept des Passivhauses.
Natürlich sind die genannten Zahlenwerte nur als ein einigermaßen typisches Beispiel zu verstehen; konkrete Fälle können hiervon erheblich abweichen.
Bei Mehrfamilienhäusern ist die Situation deutlich günstiger als bei Einfamilienhäusern. Die äußere Oberfläche wächst nämlich bei Weitem nicht so schnell an wie das bewohnte Volumen, sodass die Transmissionswärmeverluste pro Quadratmeter Wohnfläche deutlich geringer ausfallen. Hauptsächlich deswegen ist es bei Mehrfamilienhäusern deutlich einfacher, das Prinzip des Passivhauses zu realisieren. Dies ist oft auch durch eine grundlegende energetische Sanierung eines ursprünglich energetisch sehr ungünstigen Altbaus mit begrenztem Aufwand erreichbar. Dagegen ist es bei vielen alten Einfamilienhäusern kaum mehr möglich, mit einer energetischen Sanierung dieses Ziel zu erreichen.
Sommerlicher Wärmeschutz
An Tagen mit hoher Außentemperatur entfallen die Transmission- und Lüftungsverluste, oder es erfolgt sogar ein Wärmeeintrag von außen nach innen (vor allem durch eine fehlende Wärmedämmung unter den oft sehr heiß werdenden Dachziegeln). Da zusätzlich noch gewisse innere und solare Gewinne auftreten, kann die Raumtemperatur dann auf recht hohe Werte ansteigen. Um bei komfortablen Temperaturen zu bleiben, möchte man dann vor allem die solaren Gewinne minimieren. Ein Stück weit erfolgt dies im Sommer oft automatisch dadurch, dass das Sonnenlicht relativ steil einfällt und nur noch wenig davon durch senkrechte Fensterflächen gelangt. Ergänzend kann vor allem an schrägen Dachfenstern ein Sonnenschutz eingesetzt werden. Mit solchen Maßnahmen erübrigt sich in Mitteleuropa üblicherweise der Einsatz einer Klimaanlage mit Kälteaggregat zum Ausgleich der Energiebilanz.
Die Temperaturschwankungen, die vor allem im Sommer durch den tageszeitlich stark schwankenden Wärmeeintrag entstehen, fallen geringer aus, wenn das Haus über großzügig bemessene wärmespeichernde Massen verfügt. Problematisch sind dagegen häufig ausgebaute Räume unter dem Dach, die nur von geringen Massen (z. B. Rigips-Wänden und Holzböden) umgeben sind, sodass bereits ein moderater Wärmeeintrag am Tag zu einem erheblichen Temperaturanstieg führt.
Siehe auch: Wärme, Wärmedämmung, Transmissionswärmeverlust, Lüftungsverluste, solare Gewinne, Passivhaus, Sonnenschutz
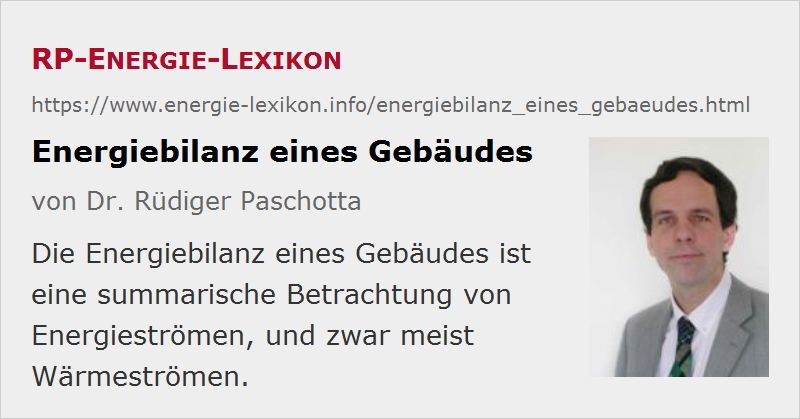
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!