Primärenergiefaktor
Akronym: PEF
Definition: ein Faktor zur Bewertung unterschiedlicher Energiearten
Englisch: primary energy factor
Kategorien: Energieträger, Grundbegriffe
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta
Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen
Ursprüngliche Erstellung: 11.08.2010; letzte Änderung: 05.07.2025
URL: https://www.energie-lexikon.info/primaerenergiefaktor.html
Bei Vergleichen des Energieverbrauchs z. B. verschiedener Gebäude tritt das Problem auf, dass unterschiedliche Arten von Energieträgern (also von Endenergie) eingesetzt werden, die nicht direkt miteinander vergleichbar sind, weil sie z. B. sehr unterschiedliche Eigenschaften bzgl. Effizienz der Bereitstellung, Versorgungssicherheit und Klimaschädlichkeit haben. Deswegen multipliziert man für solche Vergleiche den Energieverbrauch (Verbrauch an Endenergie wie z. B. Erdgas, Fernwärme oder elektrische Energie) jeweils mit einem Gewichtungsfaktor, dem sogenannten Primärenergiefaktor (in der Schweiz auch Endenergiefaktor), dessen Wert von der Art der eingesetzten Energie abhängt. Der resultierende Wert kann dann z. B. darüber entscheiden, ob das Gebäude diesbezüglich einen bestimmten Energiestandard (z. B. EnEV 2014 oder Minergie) erfüllt oder nicht.
In der einfachsten Form ist der Gewichtungsfaktor einfach das Verhältnis der Mengen von Primärenergie und Endenergie, so dass man durch Multiplikation damit effektiv den Primärenergiebedarf berechnet. Jedoch bleibt auch dann das Problem, dass beispielsweise der Verbrauch einer Kilowattstunde aus Erdöl beispielsweise mit Blick auf Versorgungssicherheit und Klimagefahren völlig anders bewertet werden sollte als der einer Kilowattstunde aus Holz oder aus Sonnenenergie. Deswegen wird das System üblicherweise so modifiziert, dass die Gewichtungsfaktoren für erneuerbare Energien Null sind oder (bei Holz) zumindest recht kleine Werte haben. Es handelt sich also nicht um einen physikalischen Faktor, sondern einen für eine sachgerechte Bewertung unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte festgelegten Faktor.
Die Werte für Kohle, Heizöl, Erdgas u. ä. werden nach EnEV als 1,1 oder 1,2 angesetzt, nicht 1 wie nach den Minergie-Regeln. Damit berücksichtigt man, dass bereits die Bereitstellung dieser Energieträger beim Endverbraucher einen gewissen Energieverbrauch verursacht. Beispielsweise werden Erdölprodukte in Erdölraffinerien verarbeitet, in denen ein Teil der Energie des Rohöls verloren geht. Außerdem entsteht ein Energieaufwand für den Transport beispielsweise in Pipelines und Tankwagen.
Einen objektiv richtigen Wert z. B. für Holz gibt es nicht – nicht nur, weil der Aufwand an nicht erneuerbarer Energie bei der Holzgewinnung unterschiedlich hoch sein kann, sondern auch wegen möglicher Verdrängungseffekte: Eine Zunahme des Holzverbrauchs an einer Stelle könnte bei eng werdenden Märkten den Holzeinsatz an anderer Stelle reduzieren, also z. B. den Einsatz von Erdgas erhöhen. Je stärker solche Verdrängungseffekte werden, desto höher sollte der Primärenergiefaktor für Holz angesetzt werden.
| Energieträger | Primärenergiefaktor nach EnEV 2014 | Gewichtungsfaktor nach Minergie |
|---|---|---|
| Steinkohle | 1,1 | 1 |
| Braunkohle | 1,2 | 1 |
| Heizöl | 1,1 | 1 |
| Erdgas und Flüssiggas | 1,1 | 1 |
| elektrische Energie aus nicht erneuerbaren Quellen | 1,8 | 2 |
| Holz | 0,2 | 0,5 |
| Nah- und Fernwärme aus Heizwerken |
0,1 bzw. 1,3 | 1 |
| Nah- und Fernwärme aus Heizkraftwerken (mit Kraft-Wärme-Kopplung) |
0 bzw. 0,7 | 0,6 |
| Solarenergie und Umgebungswärme | 0 | 0 |
Als Beispiele gibt die Tabelle die Primärenergiefaktoren gemäß der deutschen Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) sowie nach dem schweizerischen Minergie-Standard an. Bei Nah- und Fernwärme gelten die kleineren Zahlenwerte bei Verwendung erneuerbarer Energieträger, die größeren bei Verwendung fossiler Brennstoffe.
Das GebäudeEnergieGesetz 2020 enthält ebenfalls detaillierte Regeln für die Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs mithilfe von Primärenergiefaktoren [1].
Es gibt noch diverse andere Systeme, beispielsweise den der schweizerischen SIA, die jeweils zwei unterschiedliche Primärenergiefaktoren angibt: einen gesamten und einen nur für die nicht erneuerbare Energie.
Bemerkenswert ist, dass die verwendeten Primärenergiefaktoren für Strom tendenziell sinken. Beispielsweise galt für Strom aus nicht erneuerbaren Quellen gemäß EnEV 2014 zunächst der Wert 2,4, seit 2016 aber nur noch 1,8. Dies wird damit begründet, dass die Stromerzeugung tendenziell umweltfreundlicher wird (z. B. in Deutschland mit deutlich zunehmenden Anteil von Wind- und Solarstrom). Allerdings ist dies nicht ganz nachvollziehbar, da es ja um den nicht erneuerbaren Anteil geht.
Im Falle von Elektrowärmepumpen sieht man, dass eine hohe Leistungszahl wichtig ist, um trotz des relativ hohen Primärenergiefaktors von Strom eine gute Bilanz zu erzielen. Dies liegt daran, dass die Energieverluste bei der Stromerzeugung in Wärmekraftwerken einen großen Teil des Gewinns der Wärmepumpen (aus der Nutzung von Umweltwärme) wieder zunichte machen.
Die Erzeugeraufwandszahl z. B. eines Heizkessels kann man mit dem Primärenergiefaktor des Brennstoffs multiplizieren, um die Anlagenaufwandszahl zu erhalten.
Literatur
| [1] | Infos zu Primärenergiefaktors im GebäudeEnergieGesetz 2020, https://www.geg-info.de/geg/022_%A7_primaerenergiefaktoren.htm |
Siehe auch: Energie, Primärenergie, Endenergie, Aufwandszahl, Klimagefahren, Versorgungssicherheit, Energieeinsparverordnung
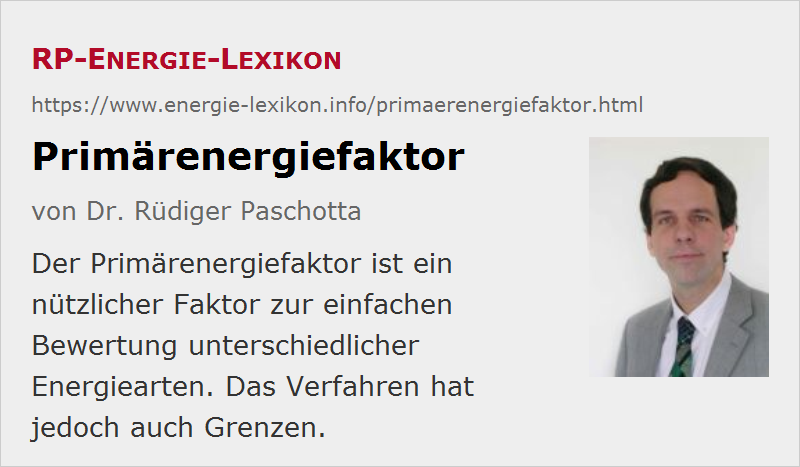
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!