Atomausstieg
Definition: Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie
Alternativer Begriff: Kernenergieausstieg
Englisch: nuclear phase-out
Kategorien: Energiepolitik, Kernenergie
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta
Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen
Ursprüngliche Erstellung: 05.06.2011; letzte Änderung: 22.03.2025
Unter Atomausstieg versteht man den Ausstieg aus der (zivilen) Nutzung der Kernenergie. Da die Kernenergie in aller Regel zur Erzeugung elektrischer Energie (Stromerzeugung) in Kernkraftwerken verwendet wird, bedeutet dies den Ersatz der Kernkraftwerke durch andere Arten von Kraftwerken – eventuell ergänzt durch Maßnahmen, die den Bedarf an elektrischer Energie vermindert, beispielsweise über erhöhte Energieeffizienz. So wird der Atomausstieg zur zentralen Komponente eines umfassenderen Umbaus der Stromversorgung, auch als Energiewende bezeichnet. Diese umfasst gleichzeitig auch andere Aspekte, insbesondere die Reduktion von Kohlendioxid-Emissionen als Beitrag zum Klimaschutz.
Formen des Atomausstiegs
Die extremste Form des Atomausstiegs ist die sofortige Abschaltung und Außerbetriebnahme sämtlicher Kernkraftwerke – womöglich unvorbereitet als Reaktion auf einen besorgniserregenden Reaktorunfall. Dies wäre jedoch mit einer plötzlichen Verminderung der verfügbaren Kraftwerkskapazität verbunden, würde also je nach Abhängigkeit von der Atomenergie eine sofortige Verminderung des Verbrauchs an elektrischer Energie erzwingen, und wäre mit massiven wirtschaftlichen Verlusten verbunden. Auch die Versorgungssicherheit dürfte gefährdet sein. Angesichts dieser Kosten und Gefahren erhält die Forderung nach einem sofortigen Atomausstieg meist nur dann breitere Unterstützung, wenn die Bevölkerung enorm beunruhigt ist. Sonst wird ein gewisses Restrisiko in Kauf genommen, um die konkret absehbaren schweren Nachteile zu vermeiden.
Im Gegensatz hierzu ist die mildeste Form eines Atomausstiegs lediglich der Verzicht auf den Neubau von Atomkraftwerken, aber der Weiterbetrieb aller existierender Kernkraftwerke, solange dieser sicherheitstechnisch für akzeptabel gehalten wird (wobei die Meinungen hierüber sehr differieren und sich bei Politikern und in der Bevölkerung auch sehr schnell ändern können).
Weitere Varianten liegen zwischen diesen Extremen: Zum Verzicht auf Kraftwerksneubauten kommt eine mehr oder weniger strikte Begrenzung der Restlaufzeiten existierender Kraftwerke. Dies kann entweder mit von Anfang an festgelegten Parametern erfolgen oder mit einem bewusst gelassenen Entscheidungsspielraum für spätere Jahre.
In Deutschland ergab sich der Atomausstieg in mehreren Phasen:
- Zunächst beschloss in 2000 die damalige rot-grüne Bundesregierung den Atomausstieg im Rahmen einer umfassenden Vereinbarung (Atomkonsens) mit den Kraftwerksbetreibern. Hierbei wurden gewisse Strommengen vereinbart, die noch erzeugt werden durften – wobei Reststrommengen alter Anlagen auf jüngere Anlagen übertragen werden durften. Das genaue Abschaltdatum für die einzelnen Kraftwerke war damit nicht festgelegt. Der Atomkonsens blieb in der Politik umstritten.
- In 2010 beschloss die dann schwarz-gelbe Bundesregierung eine erhebliche Verzögerung des Atomausstiegs, also eine Laufzeitverlängerung um 8 Jahre für die älteren Kraftwerke (gebaut vor 1980) und 14 Jahre für die neueren.
- Kurz nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima beschloss dieselbe Bundesregierung dann doch einen wesentlich schnelleren Atomausstieg, nachdem die Akzeptanz der Kernenergie in der Bevölkerung massiv gelitten hatte. Einige Monate später wurden mehrere der älteren Kernkraftwerke außer Betrieb genommen, und die verbleibenden sollten spätestens Ende 2022 abgeschaltet werden.
- Seit April 2023 (also mit geringfügiger Verspätung) wurde Deutschland dann tatsächlich atomstromfrei. Zwar wird zeitweise immer noch Atomstrom insbesondere aus Frankreich importiert, aber die Stromexporte z. B. in 2024 waren immer noch fast doppelt so hoch wie die Importe. Das liegt auch daran, dass Frankreich von Aushilfen durch deutsche Kohle- und Gaskraftwerke stark abhängig ist.
Die volkswirtschaftlichen Kosten des Atomausstiegs wurden leider durch die Wendungen der Energiepolitik massiv erhöht. Beispielsweise führte das Hin und Her zu Schadensersatzforderungen der Energieversorger, die die Bundesregierung mit Steuerngeldern in 2021 kompensieren musste. Schwerer zu beziffern sind Verluste durch mangelnde Planungssicherheit der Energiewirtschaft, die sicherlich zu wesentlichen Fehlinvestitionen führte.
Gründe für oder gegen einen Atomausstieg
Übersicht über die wichtigsten Argumente
Es gibt verschiedene Gründe, die für oder gegen einen Atomausstieg sprechen. Die Gründe dafür sind im Wesentlichen die folgenden:
- Ein Atomausstieg verhindert, sobald er gänzlich realisiert ist, die Gefahr schwerer Unfälle in Kernkraftwerken, die unter Umständen zur radioaktiven Verseuchung großer Landstriche führen können. In einer Übergangszeit, in der noch ein Teil der Atomkraftwerke betrieben wird, ist diese Gefahr immerhin vermindert.
- Ein Atomausstieg vermindert die erzeugten Mengen radioaktiver Abfälle ("Atommüll"), die für sehr lange Zeiträume eine Gefahr darstellen und sicher gelagert werden müssen. Allerdings verbleibt natürlich die Endlagerproblematik für die zuvor entstandenen Mengen von Atommüll.
- Durch einen Atomausstieg erübrigen sich teure und teils gefährliche Maßnahmen, die bei einer langfristigen Nutzung der Kernenergie in den nächsten Jahrzehnten notwendig würden – zunächst weitere Investitionen in die Reaktorsicherheit, mittelfristig insbesondere der Einstieg in eine Plutoniumwirtschaft mit Wiederaufarbeitungsanlagen und schnellen Brutreaktoren. Die bisherige, das Uran sehr ineffizient nutzende Technologie der Leichtwasserreaktoren würde die Uranvorräte nämlich bald erschöpfen, und das nutzbare Uranangebot wird auch durch den Konflikt mit Russland reduziert.
- Die längerfristigen Kosten der Stromerzeugung fallen mit Atomausstieg voraussichtlich deutlich geringer aus, da die Kosten der nuklearen Stromerzeugung (mit neuen Kraftwerken) massiv steigen, während die Kosten der erneuerbaren Energie stetig fallen. Man sieht dies u. a. daran, dass staatliche Subventionen für neue Kernkraftwerke (z. B. in Großbritannien) pro erzeugter Kilowattstunde massiv höher sind als z. B. für Windenergie.
- Der Atomausstieg von Ländern wie Deutschland macht es einfacher, andere Länder von der Kernenergienutzung abzuhalten – allein schon dadurch, dass gezeigt wird, dass dies auch für ein Industrieland möglich ist. Auf diese Weise wird nicht nur die Gefahr schwerer Atomunfälle auch im Ausland vermindert, sondern vor allem auch die Gefahr der weiteren Verbreitung von Atomwaffen. (Natürlich wird der Verlust auf die atomar/militärische Option von gewissen Kreisen als schwerwiegendes Problem betrachtet, etwa als eine Bedrohung der militärischen Sicherheit des eigenen Landes.)
- Der Atomausstieg schafft eine klare Perspektive für die Entwicklung alternativer Energiequellen, insbesondere für erneuerbare Energie, sowie für das entschiedene Streben nach einer höheren Energieeffizienz mit technischen und anderen Maßnahmen. Ein Land, welches hier als Vorreiter agiert, könnte auf diese Weise in Zukunft erhebliche Exportchancen gewinnen.
- Für die Energiewirtschaft wird generell die Planungssicherheit erhöht. Der vorläufige Verzicht auf einen Atomausstieg kann nämlich plötzlich eine wesentlich schnellere Kursänderung politisch erzwingen, wenn durch einen zukünftigen schweren Reaktorunfall (im Inland oder Ausland) die Akzeptanz der Kernenergie in der Bevölkerung stark reduziert wird (wie es in Deutschland in 2011 geschah). Ein Atomausstieg kann dagegen einen klaren Fahrplan herbeiführen, für den weniger wahrscheinlich drastische Änderungen durch äußere Ereignisse erzwungen werden können.
Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe von Argumenten gegen einen Atomausstieg oder zumindest gegen einen raschen Atomausstieg:
- Die vorzeitige Außerbetriebnahme bereits gebauter Kraftwerke stellt eine Vernichtung von Kapital dar, die voraussichtlich zu einer gewissen Erhöhung der Strompreise führt, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Dies ist nachteilig für diverse Verbraucher, andererseits aber eher vorteilhaft für Anbieter konkurrierender Technologien. (Natürlich steht dieser sicheren Kapitalvernichtung die Möglichkeit wesentlich größerer wirtschaftlicher Einbußen im Falle eines schweren Atomunfalls gegenüber.)
- Der Ersatz von Kernkraftwerken durch andere Arten von Kraftwerken führt zu Nachteilen ökologischer Art. Zumindest kurzfristig werden in einem Land mit erheblichem Kernenergieanteil an der Stromerzeugung keine ausreichenden Mengen umweltfreundlicher erneuerbarer Energie zur Verfügung stehen, und kein wesentlicher Teil des Strombedarfs kann kurzfristig eingespart werden. Dies bedeutet, dass für eine Übergangszeit diverse fossil befeuerte Kraftwerke – insbesondere Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke – vermehrt genutzt werden. (Zusätzliche neue Kraftwerke dieser Arten werden gebaut werden, und bereits vorhandene stärker ausgelastet werden.) Dies führt zu höheren klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen, zusätzlich zu anderen gesundheitsschädlichen Emissionen (zum Teil sogar zu radioaktiven Emissionen aus Kohlekraftwerken). (Siehe Bemerkungen hierzu weiter unten.) Deutschlands Bemühungen der Dekarbonisierung bei der Stromerzeugung wären mit einem langsamerem Atomausstieg deutlich schneller vorangekommen, und vom verbleibenden CO2-Budget wäre weniger verbraucht worden.
- Ebenfalls nimmt zumindest vorübergehend der Import elektrischer Energie aus dem Ausland zu, oder (im Falle von Deutschland) der Netto-Export nimmt ab. Importstrom sowie entfallender Exportstrom dürfte vorwiegend mit fossil befeuerten Kraftwerken erzeugte Energie sein, weniger Kernenergie, da die meisten vorhandenen Kernkraftwerke als Grundlastkraftwerke ohnehin so stark wie möglich eingesetzt werden, also kaum freie nukleare Kapazitäten vorhanden sind. (Eine Ausnahme ist Frankreich im Sommer, weil dort der Atomstromanteil über dem Grundlastbedarf liegt.) Ob eine vorübergehende Vergrößerung der Nachfrage auf dem internationalen Strommarkt zu zusätzlichen Kernkraftwerksbauten im Ausland führen kann, ist zumindest sehr fraglich.
- Ein sehr schnell erfolgender Atomausstieg (nicht wie in Deutschland, sondern etwa politisch erzwungen durch eine Reaktorkatastrophe) kann auch die Versorgungssicherheit beeinträchtigen, also die Gefahr von Stromausfällen vergrößern, wenn nicht rechtzeitig Ersatzkapazitäten in genügendem Umfang gefunden werden. (Es entsteht eine Stromlücke.) Im Falle umfangreicherer Stromausfälle würde dies zu großen wirtschaftlichen Schäden führen. Um dies zu verhindern, könnten vorübergehende Produktionsunterbrechungen in gewissen Industrien nötig sein.
- Ein gewisser Ausbau der Stromnetze mit zusätzlichen und verstärkten Hochspannungsleitungen ist notwendig, wenn verstärkt erneuerbare Energien genutzt werden. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um eine dramatische Ausweitung der Kapazitäten, und wesentliche Effekte auf die Strompreise sind nicht zu erwarten.
Zusammenhang mit Klimaschutz
Der Klimaschutz wird häufig als ein Argument gegen einen Atomausstieg vorgebracht, da Kernenergie nur eine geringfügige Klimabelastung erzeugt. Dies kann man national oder international betrachten:
- Für ein Land wie Deutschland oder Frankreich bedeutet der Atomausstieg eine erhebliche Verzögerung des Fortschritts beim Klimaschutz, da Kohle- und Gaskraftwerke dann wesentlich länger benötigt werden. Andererseits besteht gerade ohne Atomausstieg die Gefahr, dass die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und damit auch die Klimabelastung durch einen Atomunfall massiv steigt, und zwar für viele Jahre. Japan ist hierfür ein eindrückliches Beispiel. Hätte Japan ähnlich wie Deutschland schon in 2000 einen Atomausstieg langfristig geplant, wäre es in 2011 weit weniger von der Atomenergie abhängig gewesen, und nach 2011 weit weniger von fossilen Energieträgern, weil es dann die erneuerbaren Energien ausgebaut und die Energieeffizienz verbessert hätte.
- International gesehen hat die Kernenergie wegen ihres ohnehin geringen Anteils am globalen Energieumsatz für den Klimaschutz wenig Bedeutung. Sie deckte in 2011 ca. 2,5 % des Endenergiebedarfs ab, und nach über 10 Jahren hat sich daran wenig geändert. Ein signifikanter Beitrag zum Klimaschutz würde einen massiven Ausbau der Kernenergie weltweit voraussetzen, was vor allem wegen der enormen Kosten aber völlig unrealistisch ist. Dies könnte sich höchstens ändern, wenn die Kosten (und idealerweise auch die Gefahren) durch neue Technologien massiv gesenkt werden könnten – was aber nach Jahrzehnten der Forschung und Entwicklung weiterhin nicht als realistische Möglichkeit erkennbar ist.
Insgesamt ist klar, dass Erfolg oder Scheitern des Klimaschutzes keineswegs von der Kernenergie abhängen, sondern dadurch entschieden werden, inwieweit und wie schnell sich erneuerbare Energie und Energieeffizienz durchsetzen – abgesehen von anderen wichtigen Sektoren wie Landnutzung.
Komplexe Abwägungen
Eine rationale Entscheidung für oder gegen einen Atomausstieg, bzw. für ein bestimmtes Tempo des Ausstiegs, muss offensichtlich auf einer Abwägung einer Vielzahl von Vor- und Nachteile basieren, die ganz unterschiedliche Aspekte betreffen und deswegen schwer objektiv gegeneinander aufzurechnen sind. Unvermeidlich kommen dabei subjektive Aspekte ins Spiel. Beispielsweise werden diverse Gefahren unterschiedlich eingeschätzt und bewertet: die Wahrscheinlichkeit schwerer Atomunfälle, die Gefahr der Weiterverbreitung von Atomwaffen durch die zivile Kernenergienutzung sowie die Gefahr wirtschaftlicher Einbußen durch Mehrkosten eines Atomausstiegs. Ebenfalls gibt es unterschiedlich optimistische Einschätzungen z. B. betreffend die Wirksamkeit technischer Maßnahmen gegen Atomunfälle, die Entwicklung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit erneuerbarer Energien und die Potenziale erhöhter Energieeffizienz im Falle entschiedener Maßnahmen in dieser Richtung. Eine Gefahr besteht auch darin, dass eine Regierung zwar einen Atomausstieg beschließt, aber nicht ausreichende Mittel einsetzt, um diesen auch umzusetzen und seine negativen Auswirkungen z. B. auf die CO2-Emissionen und die Versorgungssicherheit zu minimieren.
Literatur
Siehe auch: Kernenergie, Kernkraftwerk, Energiewende, Stromlücke, Versorgungssicherheit, Energiepolitik
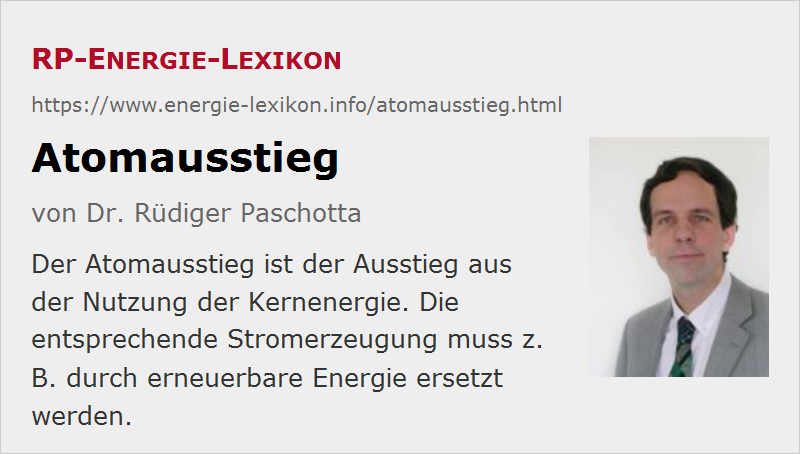
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!