Verbrennungsmotor
Definition: ein Motor, der mit Energie aus der Verbrennung eines Kraftstoff betrieben wird
Allgemeiner Begriff: Wärmekraftmaschine
Spezifischerer Begriff: Motor mit innerer oder äußerer Verbrennung
Englisch: combustion engine
Kategorien: Fahrzeuge, Kraftmaschinen und Kraftwerke
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta
Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen
Ursprüngliche Erstellung: 10.03.2010; letzte Änderung: 05.07.2025
URL: https://www.energie-lexikon.info/verbrennungsmotor.html
Verschiedene Arten von Verbrennungsmotoren (oder Verbrennungskraftmaschinen) sind Wärmekraftmaschinen, die chemische Energie aus Kraftstoffen in mechanische Energie (Antriebsenergie) umwandeln. Sie sind insbesondere für mobile Anwendungen sehr wichtig, da die verwendeten meist flüssigen Kraftstoffe eine hohe Energiedichte aufweisen und somit die Mitführung von viel Energie ermöglichen. Jedoch werden auch für diverse stationäre (ortsfeste) Anwendungen Verbrennungsmotoren eingesetzt, vor allem im Bereich kleinerer Leistungen, wo Dampf- und Gasturbinen weniger gebräuchlich sind.
Arten von Verbrennungsmotoren
Die wichtigsten Arten von Verbrennungsmotoren:
- Ottomotoren sind in der Regel Hubkolbenmotoren mit fremdgezündeter innerer Verbrennung, die in vielen Variationen gebaut werden. Als Kraftstoff dient meistens Benzin, oft mit Beimischung von Ethanol, manchmal auch Erdgas. Auch eine Anpassung an andere Kraftstoffe wie Methanol oder Wasserstoff ist möglich.
- Dieselmotoren sind ebenfalls Hubkolbenmotoren mit innerer Verbrennung (siehe unten), die jedoch selbstzündend sind. Sie werden mit einem meist erdölbasierten Dieselkraftstoff betrieben oder mit Rapsmethylester (RME) in reiner Form oder als Beimischung. Auch Pflanzenöle sind verwendbar.
- Stirlingmotoren und Ericssonmotoren sind Hubkolbenmotoren mit äußerer Verbrennung, die kontinuierlich arbeitet. Dies ermöglicht die Nutzung einer breiteren Palette von Brennstoffen und sogar von konzentrierter Solarwärme. Ein Nachteil ist, dass die Motorleistung weniger schnell dem Bedarf angepasst werden kann.
- Dampfmotoren arbeiten ebenfalls mit äußerer Verbrennung und mit Wasserdampf als Arbeitsmedium.
Innere Verbrennung bedeutet, dass der Kraftstoff z. B. innerhalb eines Zylinders des Motors verbrannt wird, wobei das entstehende heiße Gas als Arbeitskreis dient. Motoren mit äußerer Verbrennung können dagegen kontinuierlich von außen angelieferte Wärme nutzen.
Wirkungsgrade
Der Wirkungsgrad von Verbrennungsmotoren variiert deutlich für verschiedene Motorentypen, besonders stark aber hängt er von den Betriebsbedingungen ab:
- Der Wirkungsgrad erreicht sein Maximum normalerweise für volle oder jedenfalls recht starke Auslastung, d. h. wenn der Motor annähernd das maximal mögliche Drehmoment erzeugt. Bei niedriger Last wird der Wirkungsgrad meist sehr schlecht. Selbst im Leerlauf wird eine erhebliche Menge von Kraftstoff benötigt.
- Die Drehzahl ist ebenfalls wichtig. Sie sollte nicht höher sein als benötigt für die jeweilige Leistung. Eine Reduktion der Leistung wird meist effizienter durch Absenkung der Drehzahl vorgenommen (im Auto: höheren Gang wählen) als durch Reduktion der Zufuhr von Kraftstoff und Luft ("Gas wegnehmen").
- Vor Erreichen der vorgesehenen Betriebstemperatur kann der Wirkungsgrad ebenfalls vermindert sein.
Im idealen Betriebszustand bei hoher Last können Ottomotoren Werte von 35 % oder bei besonderer Optimierung sogar annähernd 40 % erreichen. Dieselmotoren erreichen im optimalen Betriebszustand auch mehr als 40 %, vor allem mit Direkteinspritzung und Turboaufladung und bei großen Motoren. Große Schiffsdieselmotoren erzielen sogar Wirkungsgrade in der Gegend von 50 %.
Tendenziell erreicht man bei kleineren Motoren weniger hohe Wirkungsgrade. Dies hat unterschiedliche Ursachen; vor allem sind diverse Verlustmechanismen dort relativ gesehen bedeutender. Beispielsweise ist das Verhältnis von Volumen und Oberfläche des Brennraums ungünstiger, sodass das Problem des Wärmeverlustes der Verbrennungsgase an die Wände des Brennraums verhältnismäßig größer ist. Auch Reibungsverluste sind bei kleinen Motoren relativ gesehen stärker. Ein anderer Faktor ist, dass große Motoren häufig lange Laufzeiten aufweisen, sehr große Energiemengen umsetzen und deswegen sorgfältiger optimiert werden.
Ökologische Aspekte
Die Abgase von Verbrennungsmotoren enthalten in aller Regel wesentlich mehr Schadstoffe wie z. B. Stickoxide, verglichen etwa mit Heizkesseln basierend auf den gleichen Brennstoffen. Dies gilt zumindest für Motoren mit innerer Verbrennung, da diese recht schnell abläuft und unter weniger gut kontrollierten Bedingungen. Die Art und Menge von Schadstoffbelastungen kann stark von der Art des Motors, den Eigenschaften des Kraftstoffs sowie von den Betriebsbedingungen (Leistung, Drehzahl, Betriebstemperatur) abhängen.
Die Abgasproblematik kann erheblich entschärft werden durch eine nachgelagerte Abgasreinigung, insbesondere mit Abgaskatalysatoren (gegen Stickoxide, Kohlenmonoxid und unverbrannte Kohlenwasserstoffe) und Partikelfiltern (gegen Ruß, Sulfatpartikel u. ä.). Je nach Motortyp können deutlich unterschiedliche Abgasreinigungsverfahren anwendbar sein.
Zusätzlich zu den oben genannten gesundheitsschädlichen Schadstoffen gibt es die Problematik der klimaschädlichen CO2-Emissionen, da die allermeisten Kraftstoffe für Verbrennungsmotoren Kohlenstoff enthalten, der bei der Verbrennung zu Kohlendioxid (CO2) wird. Dieses wird in aller Regel über die Abgase in die Atmosphäre geleitet und wirkt dort als Treibhausgas, trägt also zur Klimaerwärmung bei. Diese Problematik lässt sich technisch sehr viel schwerer entschärfen – beispielsweise durch die Verwendung von Wasserstoff, der dann aber auf Klimaverträge Weise erzeugt werden müsste.
Der Artikel über Messverfahren für Kraftstoffverbrauch und Abgaswerte behandelt Testverfahren, die für Fahrzeuge verwendet werden, um deren Emissionen unter genormten Bedingungen quantitativ zu erfassen.
Zukunft des Verbrennungsmotors für Autos
In immer mehr Ländern wird ein Ausstieg aus der Technologie des Verbrennungsmotors für Autos vorbereitet, etwa mit dem vorgesehenen Verbot von Verkäufen ab einem gewissen Stichjahr. Dies ist im Wesentlichen motiviert durch durch die Notwendigkeit des Klimaschutzes; alle in ausreichendem Umfang verfügbaren Kraftstoffe für Verbrennungsmotoren sind bislang kohlenstoffhaltig, was unweigerlich zu klimaschädlichen CO2-Emissionen führt. Diese können zwar durch eine Optimierung der Energieeffizienz (Fahrzeuggewicht, Wirkungsgrad des Motors etc.) reduziert werden, aber nicht auf ein bei breiter Anwendung solcher Autos klimaverträgliches Maß.
Im Prinzip könnten Autos zukünftig klimaverträglich mit Verbrennungsmotoren betrieben werden, die Wasserstoff als Kraftstoff nutzen, welcher auf klimaverträgliche Weise (vermutlich mit Ökostrom und Elektrolyse) erzeugt werden müsste. Die Grundprobleme mit diesem Ansatz sind allerdings kaum lösbar:
- Die Energieeffizienz wäre wegen der großen Energieverluste nicht nur bei der Elektrolyse, sondern vor allem auch im Verbrennungsmotor sehr gering. Die Folge wäre, dass man ein Vielfaches der Menge an Ökostrom bräuchte im Vergleich zu Elektroautos. Da die Herstellung von grünem Strom in ausreichenden Mengen ohnehin schon eine riesige Herausforderung ist, ist dieses Problem schwerwiegend.
- Man müsste zusätzlich zur Ladeinfrastruktur für Elektroautos noch eine Infrastruktur für Wasserstofftankstellen errichten, was mit hohen Kosten verbunden wäre. Problematisch sind in diesem Zusammenhang auch die Schwierigkeiten des Transports des Wasserstoffs zu den Tankstellen. Wegen der schweren Speicherbarkeit von Wasserstoff wäre beispielsweise die Transportkapazität eines Lastwagens weitaus geringer als die eines Benzinlasters, was entsprechend mehr Fahrten notwendig machen würde.
Ein anderer Ansatz basiert auf Biokraftstoffen, die jedoch schwer wirklich klimafreundlich erzeugt werden können und vor allem wegen der (z. B. im Vergleich zu Photovoltaik) sehr niedrigen Flächeneffizienz nur in sehr begrenztem Umfang verfügbar sein werden.
Aus diesen Gründen ist eine klimafreundliche Zukunft des Verbrennungsmotors in Autos und auch größeren Fahrzeugen schwer vorstellbar. Allenfalls in Schiffen werden Verbrennungsmotoren noch länger benötigt werden, weil andere Lösungen kaum praktizierbar sind. Man wird voraussichtlich sehr große Mengen elektrischer Energie benötigen, um diese Antriebe indirekt zu elektrifizieren.
Literatur
| [1] | R. van Basshuysen und F. Schäfer (Hrsg.), Handbuch Verbrennungsmotor, Springer Vieweg |
Siehe auch: Wärmekraftmaschine, Motor, Ottomotor, Atkinson-Motor, Dieselmotor, Stirlingmotor, Kraftstoff, Kraft-Wärme-Kopplung, Kraftstoff sparen, Verbrennung, Leerlauf, Schubabschaltung, Messverfahren für Kraftstoffverbrauch und Abgaswerte
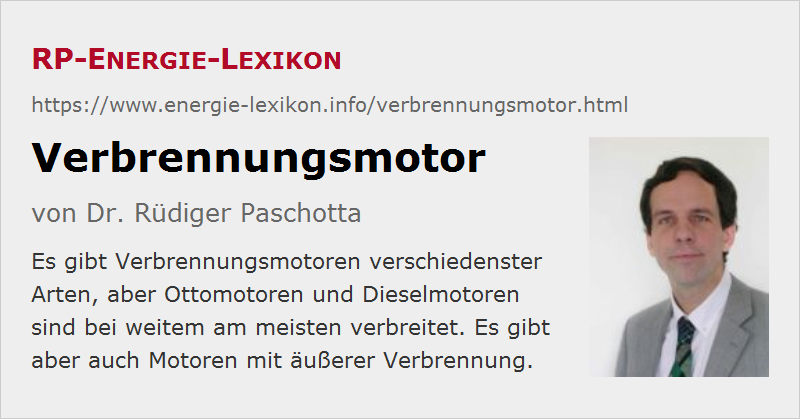
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!