Spannungshaltung
Definition: die Regelung der elektrischen Spannung in einem Stromnetz
Englisch: grid voltage stabilization
Kategorien: elektrische Energie, Grundbegriffe
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta
Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen
Ursprüngliche Erstellung: 05.01.2013; letzte Änderung: 05.07.2025
In Stromnetzen ist die elektrische Spannung, die verschiedenen Verbrauchern zur Verfügung steht, ein wichtiger Parameter. Diese Netzspannung in relativ engen Grenzen konstant zu halten, ist eine als Spannungshaltung bezeichnete Aufgabe der Netzbetreiber. Dies ist gleichermaßen relevant für die Übertragungsnetze auf der Höchstspannungsebene wie für die Verteilungsnetze auf der Mittelspannungs- und Niederspannungsebene.
Ein Versagen der Spannungshaltung könnte fatale Wirkungen haben. Insbesondere Überspannungen könnten zur Zerstörung vieler Geräte führen, und auch Unterspannungen können zumindest deren Funktion stören. Eine hohe Zuverlässigkeit der Spannungshaltung ist deswegen ein sehr wesentlicher Aspekt der Qualität der Stromversorgung.
In Deutschland muss die Netzspannung für Kleinverbraucher bei 230 V ± 10 % liegen, d. h. zwischen 207 V und 253 V. Alle Geräte müssen also so ausgelegt werden, dass sie mindestens in diesem Spannungsbereich ordnungsgemäß arbeiten. Für Glühlampen ist dieser Bereich schon relativ groß, zumal die bezogene Leistung mit der Spannung überproportional ansteigt: Bei hoher Spannung brennen sie deutlich heller und altern auch sehr viel schneller. Engere Toleranzen wären also für Glühlampen und manche anderen Verbraucher günstiger, jedoch würden diese den Aufwand für die Spannungshaltung massiv erhöhen.
Die Spannungshaltung betrifft nicht sehr kurzfristige (transiente) Phänomene, die beispielsweise durch Schalthandlungen ausgelöst werden, sondern nur längerfristige Abweichungen der Effektivwerte der Spannungen von den jeweiligen Nennwerten. Auch Abweichungen von einem sinusförmigen Spannungsverlauf sind nicht Gegenstand der Spannungshaltung. Ebenso ist die Frequenzregelung eine separate Aufgabe.
Spannungsabfall in Gleichstrom- und Wechselstromnetzen
Für die Spannungshaltung genügt es nicht, dass die einspeisenden Kraftwerke die jeweils richtige Spannung erzeugen, da entlang der Hochspannungsleitungen wie auch anderer Stromleitungen die Spannung in der Regel allmählich abfällt – vor allem wenn die Strombelastung hoch ist. In Gleichstromnetzen ergibt sich ein Spannungsabfall in einer Leitung nur aus dem ohmschen Widerstand; er ist das Produkt von Widerstand (der Leitung) und Stromstärke. In Wechselstrom- bzw. Drehstromsystemen gibt es zusätzlich wichtige Effekte von Blindströmen (als Folge komplexer Impedanzen), die bei hoher Strombelastung von Leitungen den Spannungsabfall verstärken, bei niedrig belasteten Leitungen allerdings auch zu einer Erhöhung der Spannung entlang der Leitung führen können (Ferranti-Effekt). Das Phänomen der Blindströme macht die Spannungshaltung also zunächst komplizierter, bietet allerdings auch zusätzliche Eingriffsmöglichkeiten (siehe unten).
Methoden für die Spannungshaltung
Die Netzbetreiber haben verschiedene technische Möglichkeiten zur Verfügung, um die Spannungshaltung zu gewährleisten. Zunächst einmal müssen die Stromnetze geeignet ausgelegt werden. Hierzu gehören ausreichend stark dimensionierte Leitungen, aber auch andere Einrichtungen, beispielsweise regelbare Transformatoren, Einrichtungen zur Blindstromkompensation sowie Schaltanlagen. Wenn die Netzbelastung zunimmt, müssen ggf. auch nachträgliche Ausbauten der Netze vorgenommen werden.
Im Netzbetrieb gibt es viele Möglichkeiten, bei zu großen Spannungsabweichungen einzugreifen:
- Die von den Kraftwerken gelieferte Spannung kann etwas angepasst werden. Beispielsweise kann ein Kraftwerk etwas mehr Spannung liefern, wenn die Spannung in Teilen des Netzes zu stark abfällt. Jedoch darf die Spannung auch nirgends zu hoch werden.
- In Wechselstromnetzen haben Blindströme einen wesentlichen Einfluss (siehe unten). Eingriffsmöglichkeiten bestehen einerseits in veränderten Blindleistungs-Einspeisungen der Kraftwerke und andererseits in steuerbaren Anlagen zur Blindleistungskompensation (z. B. mit Kompensations-Drosselspulen), die im Netz oder bei Verbrauchern verteilt installiert sind.
- Bei vielen Transformatoren kann das Übersetzungsverhältnis in gewissen Stufen angepasst werden. Beispielsweise werden inzwischen vermehrt regelbare Ortsnetztransformatoren verwendet in Bereichen, wo verstärkt Einspeisungen auf der Niederspannungsebene z. B. durch Photovoltaikanlagen erfolgen.
- Auch durch Schaltungsmaßnahmen kann die Spannungshaltung unterstützt werden. Beispielsweise können Teilnetze zur Stabilisierung zusammengeschaltet werden.
- In manchen Fällen ist auch ein spannungsbedingter Redispatch notwendig, d. h. eine Änderung der Fahrpläne von Kraftwerken und somit eine Verlagerung der Energieerzeugung.
- Für den Fall von Kurzschlüssen muss eine ausreichende Kurzschlussleistung stets bereitgestellt werden.
Die Aufgabe der Spannungshaltung ist in Verteilungsnetzen deutlich anders als in Übertragungsnetzen. Generell sind weniger detaillierte Daten über den Netzzustand verfügbar, da Verteilungsnetze komplexer sind. Zudem sind die Eingriffsmöglichkeiten über Kraftwerke reduziert, weil Großkraftwerke außerhalb der Verteilungsnetze stehen und Kleinkraftwerke oft nicht gezielt vom Netzbetreiber gesteuert werden können. Transformatoren in Verteilungsnetzen sind häufig nicht regelbar; allerdings werden inzwischen zunehmend regelbare Ortsnetztransformatoren eingesetzt. Ein weiterer Aspekt ist die deutliche Asymmetrie der Belastung der Drehstrom-Phasen, d. h. es gibt relativ größere Schieflasten als im Hochspannungsnetz.
Herausforderungen durch die Einspeisung erneuerbarer Energien
Im Rahmen der deutschen Energiewende erfolgt eine zunehmende Einspeisung erneuerbarer Energie auf allen Spannungsebenen. Bei Einspeisung auf der Höchstspannungsebene (z. B. durch große Windparks) entstehen gelegentlich Engpässe der Netzkapazitäten, aber die Spannungshaltung wird insbesondere durch Einspeisungen im Mittel- und Niederspannungsnetz schwieriger. Diese Netze wurden als reine Verteilungsnetze konzipiert; wesentliche Einspeisungen waren nicht vorgesehen. Problematisch ist vor allem die fluktuierende Natur der Einspeisungen von Windenergieanlagen: Gelegentlich kommen starke Einspeisungen zu Zeiten schwacher Last vor, so dass die Netzspannung dann ansteigt. Für dieses Problem gibt es unterschiedliche Lösungen:
- An manchen Orten werden Verstärkungen des Mittelspannungsnetzes nötig sein, z. B. mit zusätzlichen Leiterseilen.
- Einfach und schnell realisierbar ist eine Abregelung (Verminderung der Einspeisung) bei zu hoher Spannung, aber damit geht Energie verloren. Deswegen ist dieser Ansatz allenfalls als Überbrückungsmaßnahme geeignet.
- Speicher für elektrische Energie, beispielsweise mit Akkumulatoren, könnten Erzeugungsspitzen speichern und diese Energie später abgeben. Diese Lösung wäre jedoch sehr teuer und würde zu zusätzlichen Energieverlusten führen.
- Kraftwerke können geeignete variable Mengen von Blindleistung einspeisen, was die Spannungsabfälle auch auf anderen Leitungen beeinflusst und somit zur Spannungshaltung beitragen kann. Dies wird zunehmend auch mit entsprechend eingerichteten Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen praktiziert. Mit dieser Methode kann die Leistung, die ohne Netzausbau eingespeist werden kann, oftmals mehr als verdoppelt werden.
- Wo insgesamt die Einspeisungen auf niedrigen Spannungsebenen sehr hoch werden, muss die Einspeisung auf höheren Spannungsebenen erwogen werden.
Siehe auch: Systemdienstleistungen, elektrische Spannung, Spannungsabfall, Netzspannung, Blindstrom, Frequenzregelung im Stromnetz, Blindleistungskompensation
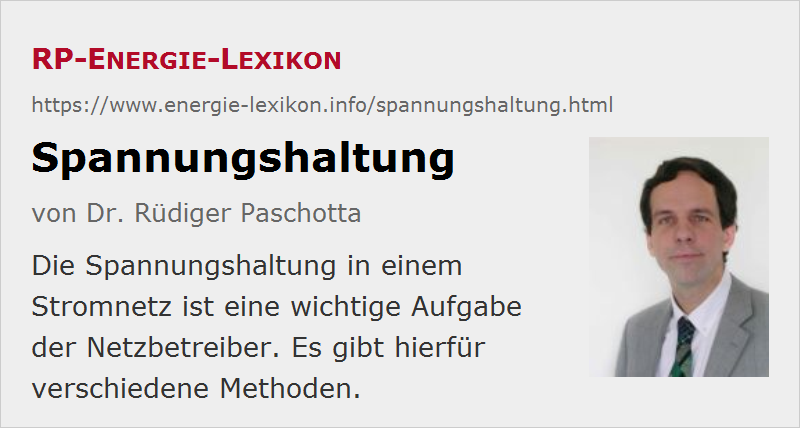
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!