Wärmekraftwerk
Definition: ein Kraftwerk, welches elektrische Energie aus Wärme gewinnt
Allgemeiner Begriff: Kraftwerk
Spezifischere Begriffe: Kohlekraftwerk, Kernkraftwerk, Gaskraftwerk, Ölkraftwerk, solarthermisches Kraftwerk
Englisch: thermal power station
Kategorien: elektrische Energie, Kraftmaschinen und Kraftwerke, Wärme und Kälte
Autor: Dr. Rüdiger Paschotta
Wie man zitiert; zusätzliche Literatur vorschlagen
Ursprüngliche Erstellung: 16.12.2012; letzte Änderung: 05.07.2025
Ein Wärmekraftwerk ist ein Kraftwerk, welches auf einer Art von Wärmekraftmaschine basiert. In ihm wird also Wärme erzeugt (oder auch der Umwelt entnommen) und mit Hilfe einer Wärmekraftmaschine teilweise in mechanische Energie umgewandelt. Der meist größere Teil der eingesetzten Wärme fällt aber als Abwärme an. Die mechanische Energie dient zum Antrieb eines Generators, der elektrische Energie erzeugt.
Arten von Wärmekraftwerken
- Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und Ölkraftwerke erzeugen Wärme durch die Verbrennung fossiler Energieträger und nutzen sie meist mit Hilfe von Dampfturbinen oder Gasturbinen, oder manchmal mit einer Kombination beider.
- Kernkraftwerke erzeugen Wärme aus nuklearer Energie (durch Kernspaltung) und verwenden ansonsten eine Dampfturbine ähnlich wie bei fossil befeuerten Kraftwerken.
- Blockheizkraftwerke und ähnliche Kleinkraftwerke ohne Abwärmenutzung arbeiten auf der Basis von Verbrennungsmotoren, beispielsweise Dieselmotoren oder Gasmotoren.
- Solarthermische Kraftwerke gewinnen Wärme aus Sonnenenergie und nutzen sie in Dampfturbinen.
- Geothermische Kraftwerke gewinnen Erdwärme. Da die verfügbaren Temperaturen hier oft relativ niedrig sind, werden häufig entsprechend angepasste Turbinen verwendet, z. B. entsprechend dem Organic Rankine Cycle (ORC).
Geeignete Standorte
Mehrere Kriterien können über die Auswahl von Standorten für (vor allem größere) Wärmekraftwerke bestimmen:
- Häufig werden sie relativ nahe von großen Verbrauchszentren gebaut, um den Transport hoher Leistungen über weite Strecken zu vermeiden.
- Idealerweise ist ein leistungsfähiger Anschluss an das Stromnetz zu geringen Kosten möglich, d. h. ohne aufwändige Verlegung von langen Leitungen.
- Es muss eine Möglichkeit bestehen, die Abwärme abzugeben, z. B. über einen Kühlturm. Zusätzlich wird in der Regel eine gewisse Menge von Kühlwasser benötigt. Deswegen ist die Nähe zu einem Fluss in der Regel eine wichtige Voraussetzung.
- Ferner muss der Brennstoff gut anlieferbar sein, also z. B. ein leistungsfähiger Anschluss für Erdgas oder die Anlieferung von Kohle per Schiff oder Bahn möglich sein.
Kraftwerksblöcke
Ein großes Wärmekraftwerk (Großkraftwerk) besteht aus einem oder mehreren Kraftwerksblöcken, die weitgehend unabhängig voneinander betrieben werden können. Ein Kraftwerksblock hat jeweils eigene Einrichtungen als Wärmeerzeuger, Dampferzeuger und Überhitzer, Dampfturbinen und Generator. Siehe auch den Artikel über Kraftwerke.
Wirkungsgrad von Wärmekraftwerken
Der Wirkungsgrad von Wärmekraftmaschinen ist physikalisch begrenzt durch den Carnot-Wirkungsgrad. Dieser wird umso höher, je höher die nutzbare Temperatur der Wärmequelle ist im Vergleich zu der Temperatur, auf der die Abwärme abgegeben werden kann. Die nutzbare Temperatur ist oft niedriger als die für den Wärmeerzeuger mögliche Temperatur, weil sie durch die Temperatur- und Druckbelastbarkeit der Materialien z. B. von Turbinenschaufeln begrenzt ist. Die höchsten Wirkungsgrade von ca. 60 % werden erreicht von Gas-und-Dampf-Kombikraftwerken, während moderne Kohlekraftwerke deutlich unter 50 % liegen. Bei alten Anlagen kommen auch Wirkungsgrade unter 40 % häufig vor.
Die genannten Wirkungsgrade von Kraftwerken beziehen sich auf die Energie in den verwendeten Energieträgern, so wie sie beim Kraftwerk angeliefert werden. Beispielsweise wird also der hohe Energieaufwand für die Gewinnung von Steinkohle, Braunkohle oder Kernbrennstoffen hierbei nicht berücksichtigt, wohl aber der Energieaufwand beispielsweise für Kohlemühlen als Teil der Kraftwerksanlage.
Die genannten Wirkungsgrade gelten für den Betrieb mit Volllast. Im Teillastbetrieb, der z. B. im Lastfolgebetrieb oder für die Bereitschaft zur Erzeugung von positiver Regelenergie nötig ist, kann der Wirkungsgrad deutlich abnehmen. Ein Betrieb mit weniger als 50 % Auslastung und/oder mit schnellen Leistungsänderungen ist meist unwirtschaftlich. Außerdem entstehen erhebliche zusätzliche Verluste (der Anfahrwärmeverbrauch), wenn ein Kraftwerk z. B. im Mittellastbetrieb täglich neu angefahren werden muss.
Der gesamte Nutzungsgrad kann erhöht werden durch Kraft-Wärme-Kopplung, d. h. durch die Nutzung der anfallenden Abwärme. Man spricht dann von Heizkraftwerken. (Wärmekraftwerke mit Dampfturbinen ohne Abwärmenutzung werden dagegen als Kondensationskraftwerke bezeichnet.) Wenn bei einem Dampfturbinenkraftwerk Nutzwärme z. B. als Fernwärme ausgekoppelt wird, sinkt meist der elektrische Wirkungsgrad etwas ab, während dies z. B. bei Kraftwerken mit Verbrennungsmotoren nicht der Fall ist.
Praktisch alle Großkraftwerke mit der Ausnahme von Wasserkraftwerken sind Wärmekraftwerke, und in den meisten Ländern erzeugen diese bisher den größten Teil der elektrischen Energie, weil viele verfügbare Energieträger zunächst einmal nur zur Erzeugung von Wärme geeignet sind. Wegen der begrenzten Wirkungsgrade dieser Kraftwerke fallen sehr große Mengen von Abwärme an, die am Standort oft kaum nutzbar ist. Sie wird dann über Kühltürme in die Atmosphäre abgegeben, zum Teil auch über Kühlwasser in Flüsse.
Die fossil befeuerten Wärmekraftwerke verursachen meist einen erheblichen Anteil der gesamten klimaschädlichen CO2-Emissionen eines Landes. Hinzu kommen andere schädliche Emissionen, die vor allem die Luftqualität beeinträchtigen, vor allem bei Kohlekraftwerken.
Eigenbedarf
Wärmekraftwerke haben einen erheblichen Eigenbedarf für den Betrieb von Komponenten wie Speisewasserpumpen, Kohlemühlen und Rauchgasreinigungsanlagen. Bei einem Kohlekraftwerk mit z. B. 500 MW elektrischer Leistung kann es sich um mehr als 20 MW handeln.
Im Betrieb wird der Eigenbedarf vom eigenen Generator gedeckt (und wird bei der Angabe des Netto-Wirkungsgrads berücksichtigt). Wenn ein Wärmekraftwerk jedoch erst hochgefahren wird, muss die Deckung des Eigenbedarfs in der Regel zunächst aus dem Stromnetz erfolgen. Ein Schwarzstart (ohne äußere Energiezufuhr) ist also nicht möglich. Nach einem größeren Stromausfall müssen also zunächst schwarzstartfähige Kraftwerke (z. B. Pumpspeicherkraftwerke) gestartet werden, bevor Wärmekraftwerke wieder in Betrieb gehen können.
Leistungsbereich und Leistungsänderungsgeschwindigkeit
Die Leistungsabgabe eines Wärmekraftwerks kann dem Bedarf angepasst werden: Kurzfristig z. B. durch Betätigung einer Regelstufe zur Veränderung der in die Dampfturbinen strömenden Dampfmenge, längerfristig durch Änderung der Feuerungsleistung. Hierbei gibt es jedoch Grenzen:
- Die Leistung kann nur in einem begrenzten Bereich verändert werden, z. B. 50 % bis 100 % der Maximalleistung, im Wesentlichen weil der Wirkungsgrad im Teillastbetrieb absinkt.
- Zusätzlich gibt es Grenzen für die Leistungsänderungsgeschwindigkeit, die durch die erlaubte Beanspruchung diverser Komponenten und/oder durch Wirkungsgradverluste begrenzt ist.
Siehe auch: Kraftwerk, Großkraftwerk, Wärmekraftmaschine, Dampfturbine, Gasturbine, Kernkraftwerk, Kohlekraftwerk, Ölkraftwerk, Gaskraftwerk, Geothermie, Solarthermie, Carnot-Wirkungsgrad, Eigenbedarf, Leistungsänderungsgeschwindigkeit
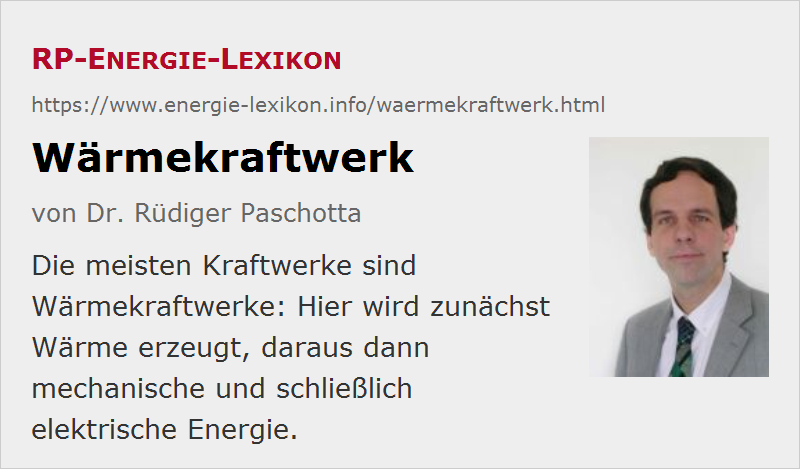
Wenn Ihnen diese Website gefällt, teilen Sie das doch auch Ihren Freunden und Kollegen mit – z. B. über Social Media durch einen Klick hier:
Diese Sharing-Buttons sind datenschutzfreundlich eingerichtet!